Startseite > Artikel > Gilles Dauvé - Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie
 Gilles Dauvé - Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie
Gilles Dauvé - Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie
Sonntag 19. Dezember 2021
Episode 01: Eine sowohl alte als auch neue Frage
Episode 02: Der Kapitalismus wird nicht ökologisch sein
Episode 03: Die Ökologie – und die Bourgeoisie
Episode 04: Scheitern der politischen Ökologie
Episode 05: Vom Anthropozän zum Kapitalozän
Episode 06: Das Ende der Welt wird nicht stattfinden
Episode 07: Ökologie: Kapitalismus oder Kommunismus?
Episode 08: Auf verlorenem Posten?
Episode 01: Eine sowohl alte als auch neue Frage

„Man berichtet uns, dass der 8. Internationale Wissenschaftskongress des Pazifiks in Manilla stattgefunden hat […], wo Spezialisten der Ökologie, der Botanik, der Zoologie, der Hydrologie, der Pädologie […] sich mit der Tatsache beschäftigt haben sollen, dass sich die moderne Menschheit in Richtung ‚der Verschwendung der Ressourcen des Planeten‘ entwickelt […]. Man will herausfinden, ob der Zyklus des Austausches zwischen der natürlichen Umwelt mit ihren materiellen und energetischen Reserven und der lebenden Menschheit hin zu einer Harmonie mit einem (theoretisch undefinierten) dynamischen Gleichgewicht oder zunehmend hin zu einem Sturz ins Ungleichgewicht tendiert und somit auf historischer Ebene unverwirklichbar wird, indem er zum Rückgang und zum Ende der Menschheit führt.“
Obwohl sie aktuell scheinen, sind diese Zeilen 1954 von Amadeo Bordiga geschrieben worden [1].
1) Problem
Die Lebensbedingungen auf der Erde hängen besonders von einem Klima ab, dessen mehrtausendjährige Entwicklung verschiedene Ursachen hat, wovon die menschliche Tätigkeit ein kleiner oder grosser Teil darstellt.
Im 16. Jahrhundert verursacht die europäische Eroberung Südamerikas durch Massaker und den Export von Krankheiten 50 Millionen Tote in einigen Jahrzehnten und die Reduzierung von Anbauflächen, Wiederaufforstung, Verringerung von Kohlenstoff in der Atmosphäre und somit des Treibhauseffekts, womit die „kleine Eiszeit“ (von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19.) akzentuiert wurde. Doch diese Entwicklung transformierte nicht die Gesamtheit der Lebensbedingungen auf der Erde. Seither hat die Industrialisierung Konsequenzen auf einem ganz anderen Niveau, was eine „grosse Beschleunigung“ ausgelöst hat, die uns einem Schwellenwert näher bringt:
„Mehrere ökologische Grenzen sind schon überschritten worden (Zerstörung der Artenvielfalt, Konzentration der Treibhausgase, Entwaldung und Zerstörung der Böden, diverse Formen der Verschmutzung), bei anderen fehlt nicht viel (Übersäuerung der Meere, Verknappung von Süsswasser). […] Zu diesen überschrittenen Grenzen kommt die Verknappung der nicht erneuerbaren ‚natürlichen Ressourcen‘ hinzu: fossile Energieträger (Erdöl, Gas, Kohle) und Mineralien, die mehr oder weniger für alle zeitgenössischen Güter und Dienstleistungen genutzt werden (wozu die Produktion von sogenannt erneuerbaren Energieträgern gehört). Wir bewohnen die Erde seit mehreren Hunderttausend Jahren, doch diese Überschreitungen haben erst seit zwei Jahrhunderten (seit der Expansion des Kapitalismus) und besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattgefunden – also vor nicht allzu langer Zeit. […] Wir stehen bei einer Erwärmung von 1° C und können jetzt schon überall auf der Welt feststellen, was sie auslöst. Wir stehen leider erst am Anfang dieser Auswirkungen. Die Ursachen dieser Störungen werden jedoch weiterhin mehr als je zuvor gefördert.“ [2]
Um nur ein Beispiel zu zitieren, auf welches wir zurückkommen werden, die stetige Erhöhung des Energieverbrauchs ist den Einsparungen und dem zunehmenden Beiträgen der „erneuerbaren Energien“ (Wind, Wasser und Sonne) immer um eine Länge voraus.
Obwohl der starke Anstieg der Temperaturen gewiss ist, ist das Ausmass ungewiss, man weiss nur, dass die Auswirkungen sich miteinander koppeln: Methanausstoss, Anstieg des Wasserspiegels, weniger Kohlenstoff absorbiert durch die Meere, verringerte Artenvielfalt (Verschlechterung und Zerstörung der Lebensräume, weniger Nahrungsquellen [Fischerei], invasive Arten), Überschwemmungen, Waldbrände, Hurrikans, Dürren, starke Gefährdung oder Verschwinden von Arten – all das führt im Verlauf des 21. Jahrhunderts zu einem wenig „bewohnbaren“ Planeten, doch für wen und welche gesellschaftliche Organisation? Wenn heute alles als „Krise“ (von 1929, der Werte, der Repräsentation, der Finanz, des Systems…) bezeichnet wird, was ist dann gegenwärtig die Verbindung zwischen der „Klimakrise“ und der „sozialen Krise“?
2) Ziel
Jede Gesellschaft muss ihre Reproduktion vorbereiten, organisieren und darüber nachdenken. Das taten auch die kapitalistischen Gesellschaften, sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert, auf verschiedene und widersprüchliche Weisen gemäss ihrer Situation, England, USA, Deutschland, UdSSR… Wie müssen sie heutzutage dieses Problem anders aufgreifen als zuvor (auch Adam Smith hatte eine „holistische“ Denkweise, aber ohne damals eine Natur zu integrieren, die als unerschöpflich betrachtet wurde)? Und was ist das Verhältnis zum Klassenkampf?
„Schöpferische Zerstörung“: Die von Schumpeter 1942 populär gemachte Formel passt besonders gut zum Thema. Sie beschrieb die kontinuierliche Verlagerung der Investitionen (die zum Verschwinden von Fabriken, Arbeitsorten und Arbeitsstellen führte) von den weniger produktiven Sektoren hin zu den rentabelsten, die Arbeitslosigkeit, Umwälzung der Berufe, Verschiebung der Tätigkeiten von einer Region oder einem Land in andere und Machttransfers von einer bürgerlichen Gruppe zu einer anderen auslöste. Doch wenn wir es mit natürlichen und materiellen Bedingungen zu tun haben, stellt sich die Frage, wie stark der Kapitalismus sie verschlechtern oder zerstören kann, um sich auf anderen Grundlagen wieder aufzubauen?
3) Methode
Um die russische Revolution, Mai 68 oder den Syndikalismus zu verstehen, reichen einige mit einem Minimum an theoretischer Intelligenz ausgewählte Schriften. „Die Ökologie“ ist hingegen das breitmöglichste intellektuelle Thema und der breitmöglichste politische Streitgegenstand, sie schliesst Geschichte, Geologie, Biologie, Chemie, Physik usw. mit ein. Wenn man darüber nachdenkt, ist man schon bald obsoleten statistischen Wasserfällen ausgesetzt, die sogleich mit anderen noch erdrückenderen und häufig widersprüchlichen ersetzt werden. Allen voran muss man also dem Rausch des Übermasses dieser Daten und Prozentsätzen widerstehen. Und welche Zahlen? Bis 2014 war es gängig (auch im Weltklimarat, Autorität in diesem Bereich), „den Kohlenstoffeffekt“ ausgehend vom Produktionsland zu messen: Der Ausstoss von CO2 von einem in China hergestellten Fernseher wurde China zugeschrieben, auch wenn ein Frachtschiff ihn nach Belgien oder Kanada transportierte, was letzteren Ländern erlaubte, sich hinsichtlich Verschmutzung als tugendhaft darzustellen. Doch man beruhigt uns: Die Statistiken sind seither korrigiert worden.
Wir spielen nicht die Oberspezialisten und streben nur nach einem theoretischen Minimum. Präzise Daten und Referenzen sind genügend zugänglich, wir werden also im Verlauf der Kapitel wenig davon liefern. Wir werden nacheinander folgende Themen behandeln:
1) Den Platz, der die kommunistische Theorie damals dem einräumen konnte, was heute Ökologie genannt wird, und den Grund, weshalb die „Ökonomie“ und die „Ökologie“ beide in diesem Kapitel von uns kritisiert werden müssen.
2) Inwiefern Kapitalismus und Ökologie inkompatibel sind.
3) Inwiefern sich die Situation verschlechtert.
4) Das Scheitern der politischen Ökologie.
5) Die theoretische Erfindung des Anthropozäns, dann jene des Kapitalozäns.
6) Die Zusammenbruchstheorie und die Kollapsologie.
7) Das Wesen des Kapitalismus und seine mögliche Überwindung.
8) Schliesslich und allen voran: die Tatsache, dass nichts verloren ist.
Wir sind weder die Ersten, noch die Letzten, die sich mit der Frage beschäftigen. Zahlreiche existierende Studien zum Thema können in diesen drei Punkten zusammengefasst werden: 1) Die kapitalistische Produktionsweise ist für das Problem verantwortlich; 2) da sie die Ursache ist, wird sie nicht die Lösung sein; aber 3) eine vernünftig von den Proletariern oder dem Volk verwaltete Wirtschaft könnte das Problem lösen. Die Leserinnen und Leser werden sehen, welche gemeinsamen Punkte und Unterschiede es zwischen dieser Sichtweise und unserer gibt.
4) Vom 19. bis ins 20. Jahrhundert
Fourier: ein leidender Planet
Beginnen wir mit dem Theoretiker der leidenschaftlichen Anziehung, der vor zwei Jahrhunderten eine dramatische Diagnose erstellte:
„Die Berge bröckeln durch die schlechte Verwaltung der Zivilisierten und Barbaren ab, die Quellen versiegen, die Temperaturexzesse, Dürren und Überschwemmungen, werden immer häufiger, die Jahreszeiten geraten immer mehr durcheinander und überlappen sich andauernd, die am meisten zivilisierten Länder haben immer tiefere klimatische Mittelwerte, der Olivenbaum ist in Frankreich um ein halbes Grad in Richtung Süden zurückgegangen, der Weinbau ist in vielen Regionen fast nicht mehr möglich, besonders im Burgund, das aufgrund klimatischer Zwischenfälle sieben Ernten nacheinander verloren hat […]“
Das schrieb Fourier (1772-1837), wobei er „die Ursachen der Veränderung“ den Gestirnen zuschrieb und eine Abkühlung diagnostizierte.
Und in Détérioration matérielle de la planète behauptete er, dass die „klimatischen Unordnungen ein der zivilisierten Kultur inhärentes Laster ist; sie stellt durch ihren Mangel an Proportionen und allgemeinen Methoden, durch den Kampf der individuellen Interessen mit dem kollektiven Interesse alles auf den Kopf […] Die zivilisierte und barbarische Landwirtschaft, von deren wundersamen individuellen Eigenschaften man schwärmt, hat die lächerliche Eigenschaft der kollektiven Verschlechterung; sie zerstört ihren eigenen Boden, statt ihn zu verbessern.“ Daher „die Dringlichkeit, schnellstmöglich den zivilisierten, barbarischen, wilden Zustand zu verlassen und das materielle Leid des Planeten zu lindern, womit auch das menschliche Elend beendet werden wird“.
Deshalb „ist im industriellen System alles lasterhaft. Es ist in jeglicher Hinsicht nur ein Wettlauf gegen die Zeit.“
Marx: der Stoffwechsel Mensch-Natur
Wer Zitate braucht, die bei Marx und Engels „ein unbestreitbares ökologisches Bewusstsein“ (Henri Peña-Ruiz) beweisen – oder widerlegen – wird sie leicht finden. Doch es geht nicht darum, eine Zusammenstellung oder eine Auswahl zu erstellen, sondern die Richtschnur oder die Richtschnüre zu finden. Einige etwas längere Zitate werden notwendig sein.
„Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ [3]
„Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben.“ [4]
„Wenn der einzelne Fabrikant oder Kaufmann die fabrizierte oder eingekaufte Ware nur mit dem üblichen Profitchen verkauft, so ist er zufrieden, und es kümmert ihn nicht, was nachher aus der Ware und deren Käufer wird. Ebenso mit den natürlichen Wirkungen derselben Handlungen. […] Gegenüber der Natur wie der Gesellschaft kommt bei der heutigen Produktionsweise vorwiegend nur der erste, handgreiflichste Erfolg in Betracht; und dann wundert man sich noch, daß die entfernteren Nachwirkungen der hierauf gerichteten Handlungen ganz andre, meist ganz entgegengesetzte sind […] [Wir beherrschen] keineswegs die Natur […], wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht - sondern […] wir [gehören] mit Fleisch und Blut und Hirn ihr an […] und [stehn] mitten in ihr […] Je mehr dies aber geschieht, desto mehr werden sich die Menschen wieder als Eins mit der Natur nicht nur fühlen, sondern auch wissen, und je unmöglicher wird jene widersinnige und widernatürliche Vorstellung von einem Gegensatz zwischen Geist und Materie, Mensch und Natur, Seele und Leib […]“ [5]
Schliesslich das von Marx in einem Fragment, das häufig als Schlussfolgerung des dritten Bandes reproduziert wird:
„[E]s erzeugt dadurch [durch das Grundeigentum] Bedingungen, die einen unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebnen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eignen Landes hinausgetragen wird. […] [D]as industrielle System auf dem Land auch die Arbeiter entkräftet und Industrie und Handel ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung des Bodens verschaffen.“ [6]
Aber was bezeichnet der Begriff des „Stoffwechsels“? Die Gesamtheit des Austausches an Materie und Energie, die ein lebendes Wesen oder ein Organismus benötigt, um fortzubestehen und sich zu reproduzieren. Im weiteren Sinne ist der gesellschaftliche Stoffwechsel gleichbedeutend mit dem Gleichgewicht, das die Erneuerung jener natürlichen Bedingungen erlaubt, welche für die menschlichen Produktionen unabdingbar sind. Marx benutzt diesen Begriff allerdings fast immer in seinen Kapiteln über die Grundrente, bezüglich des Landeigentums, „industriell betriebene große Agrikultur“, die heute zum Agrobusiness geworden ist und dem Boden die Nährstoffe entzieht – was heute hinlänglich bestätigt ist. Die von Engels zitierten Beispiele betreffen ebenfalls die Böden.
Wir sind trotzdem weit vom globalen Ungleichgewicht entfernt, das die Erde und das Menschengeschlecht im 21. Jahrhundert bedroht. Als die USA in den 1930er Jahren mit einem verheerenden, zum Teil durch die Überbeanspruchung der Böden ausgelösten Dust Bowl fertig wurden, blieb das Phänomen in jenem Rahmen, den man in der Epoche von Marx vorhersehen konnte. Sowohl hinsichtlich ihrer Ursachen als auch ihrer Folgen erreicht der zeitgenössische „Riss des Stoffwechsels“ ein qualitativ anderes Niveau. Marx konnte gewisse zerstörerische Effekte der kapitalistischen Produktionsweise verstehen und verurteilen, jedoch nicht das Ausmass der von ihr verursachten Umweltverwüstungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Es ist nutzlos, ihn in einen Vorläufer der zeitgenössischen Ökologie zu verwandeln.
Pannekoek: „Naturverwüstung“
Anton Pannekoek (1873-1960) bekräftigt 1909 im Text „Naturverwüstung“, dass die Liebe zur Natur nicht der einzige Grund ist, sich mit den Wäldern zu beschäftigen: Es geht um „Lebensinteressen für die Menschheit […] Wir wissen, dass die Menschen nun einmal die Herren der Erde sind und die Natur zu ihren Zwecken völlig umwandeln. Wir sind zu unseren Leben ganz auf die Naturkräfte und die Naturschätze angewiesen; wir müssen sie gebrauchen und verbrauchen. Nicht um diese Tatsache handelt es sich hier, sondern nur die Art und Weise, wie der Kapitalismus sie gebraucht. Eine vernünftige Gesellschaftsordnung wird die ihr zur Verfügung stehenden Schätze der Natur in solcher Weise benutzen müssen, dass nicht mehr verbraucht wird, als jeder zugleich neu aufwächst, so dass die Gesellschaft nie ärmer wird und nur reicher werden kann. […] Unter der heutigen Wirtschaftsordnung ist die Natur nicht der Menschheit sondern den Kapital dienstbar […] Die Naturschätze werden ausgebeutet, als wären die Vorräte unendlich und unerschöpflich. In den üblen Folgen der Waldverwüstung für die Landwirtschaft, in der Ausrottung nützlicher Tiere und Pflanzen tritt die Endlichkeit der Vorräte als ein Bankrott dieser Wirtschaftsweise zu Tage. Als eine Anerkennung dieses Bankrotts ist es auch zu bezeichnen, wenn Roosevelt [es handelt sich um Theodore Roosevelt, Präsident der USA von 1901 bis 1909] eine internationale Konferenz zusammenberufen will, der den Bestand der noch vorhandenen Naturschätze aufnehmen und Maßnahmen gegen ihre weitere Verschwendung treffen soll. Natürlich ist dieser Plan selbst nur Humbug. Der Staat kann zwar Vieles tun, um die ruchlose Ausrottung seltener Naturwesen zu verhindern. Aber der kapitalistische Staat ist immerhin nur ein trauriger Vertreter der Allgemeinheit der Menschen. […] Der Kapitalismus hat […] an die Stelle des Lokalbedarfs den Weltbedarf gesetzt und gewältige technische Hilfsmittel zur Ausbeutung der Natur geschaffen. Dabei handelt es sich dann sofort von ungeheuren Massen, die mit kolossalen Vernichtungsmitteln in Angriff genommen und mit mächtigen Transportmitteln weggeschafft werden. Die Gesellschaft unter dem Kapitalismus ist einem mit Riesenkraft ausgestatteten vernunftlosen Körper zu vergleichen; während er seine Kraft immer gewaltiger entwickelt, verwüstet er zugleich in sinnloser Weise die Natur, worin und wodurch er lebt.“
Einige Verwüstungen später bekräftigt Pannekoek in Antropogenese. Een studie over het ontstaan van de mens (1944): „Potenziell ist der Mensch Herr über die Natur. Doch er ist noch nicht Herr über seine eigene Natur. Wie kann er es werden?“ Durch eine Revolution, die eine gemeinschaftliche Produktion wieder einführt, und Pannekoek glaubt an „einen ununterbrochenen technischen Fortschritt, der kurz davor steht, die Menschheit als organisierte Einheit zu konsolidieren, die Herrin über ihr Leben ist“. Anton Pannekoek ist nicht ökologischer als Marx, ausser man betrachtet jeden Verteidiger der Natur so. Sein Text wurde nach einer Reihe von Niederlagen der Arbeiterklasse verfasst, nach der Krise von 1929, dem Nazismus, dem Weltkrieg und im Kontext einer andauernden Besatzung Hollands durch Deutschland: Trotz dieser niederschmetternden Tatsachen bekräftigt Pannekoek, indem er die Evolution des Menschengeschlechts Revue passiert, sein Vertrauen in eine künftige Menschheit ohne Klassen und Staat, die endlich mit sich selbst versöhnt sein würde. Die früher oder später selbstzerstörerische Herrschaft des Kapitals über die Natur ist nicht sein Thema.
Wernadski: Die Biosphäre
Die Russische Revolution beschränkt sich nicht auf die Erscheinung einer neuen Form des Kapitalismus, die von einer Klasse – der Bürokratie – angeführt wurde, welche die gleiche Rolle wie die Bourgeoisie spielte, obwohl ihr Ursprung und ihre Funktionsweise unterschiedlich war. Sie ist auch eine Gesamtheit an widersprüchlichen, ambivalenten und unvollendeten Bemühungen zur Erschaffung neuer Lebensformen, Bemühungen, die durch mangelnde Mittel hintertrieben und dann durch das Regime zerschlagen wurden.
Es ist also nicht erstaunlich, dass die Ökologie, so wie wir sie heute verstehen, in den 1920er Jahren eine wissenschaftliche und politische Realität war, bevor sie mit den Zwängen der Staatsgewalt und der Kapitalakkumulation zusammenstiess. Wladimir Wernadski (1863-1945), berühmter Mineraloge und Chemiker, „Vater der Wissenschaft“ in der Sowjetunion, beschreibt die Erde als lebenden Organismus, nicht als leblose Materie, und theoretisiert die Biosphäre als handelnde geologische Kraft. Er warnt im April 1926: „Die natürlichen Produktivkräfte […] sind in ihrer Zusammensetzung und ihrem Überfluss unabhängig vom menschlichen Willen und der menschlichen Vernunft, egal wie zentralisiert und organisiert sie auch sein mögen. Da diese Kräfte nicht unerschöpflich sind, wissen wir, dass sie Grenzen haben, […] die für unsere eigenen Produktionskapazitäten eine unüberwindbare natürliche Grenze darstellen […] für unser Land sind diese Grenzen ziemlich eng gesteckt und erlauben – mit dem Risiko einer grausamen Rechnung – keine Verschwendung im Gebrauch unserer Rohstoffe.“
Ebenfalls der Zoologe G. A. Koschewnikow 1928: „Die Entwicklung einer materialistischen Konzeption der Natur ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung, wie viele Kubikmeter Feuerholz man aus einem Wald extrahieren oder wie viel Dollar man mit Eichhörnchenleder jedes Jahr einnehmen kann […]. Die Kontrolle über die natürlichen Regulationen zu übernehmen, ist eine extrem schwierige und verantwortungsvolle Sache. [J]egliche Intervention, sogar jene, welche wir als nützlich betrachten, […] zerstört die natürlichen Bedingungen der Biozönosen. […] Aus diesem Lebensgewebe, das sich während etlichen tausend Jahre dauernden Interaktionen entwickelt hat, kann man nicht einfach schadlos ein Glied herausnehmen […]“
Doch ab 1928 fallen die guten Absichten gegenüber den Zielen des ersten Fünfjahresplans nicht wirklich ins Gewicht: Der Schutz der Natur wird nur eingeräumt, wenn er die Produktivität steigert. Was von der Ökologie bleibt (Aktionen gegen die Entwaldung und die Bodenerosion, Errichtung von Naturparks, Massnahmen, die auch von den „bürgerlichen“ Regimes ergriffen werden, besonders auf der anderen Seite des Atlantiks), zielt darauf ab, die Produktivkräfte durch ihre exzessive Entwicklung nicht zu stark aus dem Gleichgewicht zu bringen: Das Ziel des Regimes ist es, die Umwelt im Interesse des industriellen Wachstums zu erhalten.
Schutz und Erhaltung fassen die Ökologie nicht zusammen und sind weit von den gegenwärtigen Problemen entfernt.
Bordiga: Die menschliche Gattung und die Erdkruste
Nach 1950 nähert sich Amadeo Bordiga (1889-1970) in einer Artikelreihe, geschrieben nach Überschwemmungen, Unfällen, chemischen Verschmutzungen, Bodenerschöpfung und der Unfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, die Menschheit zu ernähren, der Idee an, dass die Technik kein neutrales Werkzeug ist, das ihr Wesen verändern würde, wenn sie von den Händen und Köpfen der Bourgeois in jene der Proletarier übergehen würde. Für ihn werden sich die Proletarier während der Revolution nicht damit begnügen, sich der Produktionsmittel zu bemächtigen, sie werden einen Teil davon transformieren und sich des anderen entledigen.
„Obwohl es wahr ist, dass das industrielle und wirtschaftliche Potenzial der kapitalistischen Welt ansteigt und nicht sinkt, ist es genauso wahr, dass sich, je stärker dieser Anstieg ist, sich umso mehr die Bedingungen der Menschenmasse gegenüber historischen Naturkatastrophen verschlimmern.“ [7]
Je „effizienter“ der Kapitalismus in der Ausbeutung der Arbeit und des Lebens der Menschen ist, desto weniger ist er fähig, „die Arbeit der gegenwärtigen den künftigen Generationen zu übermitteln“ [8].
„Der Kapitalismus hat seit langem eine ‚technische‘ Grundlage aufgebaut, d.h. ein Erbe an Produktivkräften, das uns bei weitem genügt; die Steigerung des produktiven Potenzials ist also – im weissen Siedlungsgebiet – nicht das grosse historische Problem, sondern durch das Verbot ihrer Ausbeutung und Verschwendung die Zerstörung jener gesellschaftlicher Formen, welche einer korrekten Verteilung und Organisation der nützlichen Kräfte und Energien entgegenstehen. Besser: Der Kapitalismus hat selbst zu viel aufgebaut und erlebt diese historische Alternative: Zerstörung oder Verschwinden.“ [9]
Die Weltrevolution wird sich, statt immer mehr aufzubauen, „die enorme Extravaganz“ erlauben können, „Kartoffeln auf dem vom Wolkenkratzer der Vereinten Nationen besetzten Terrain zu pflanzen“ [10].
In diesen Artikeln wie auch in seiner langen Studie der landwirtschaftlichen Frage bricht Bordiga allerdings nicht explizit mit der Idee, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mit jener der Natur zu ersetzten, letztere bleibt sowohl eine Partnerin als auch eine Gegnerin.
Anarchismus, Marx, Marxismus
Marx und die Marxisten waren nicht die einzigen, die an eine günstige „Entwicklung der Produktivkräfte“ glaubten. Mit einem anderen Tonfall waren andere Strömungen daran beteiligt, besonders anarchistische. In „L‘Humanisphère, utopie anarchiste“ stellte sich Joseph Déjacque (1822-1864), der Erfinder des Begriffes „libertär“, 1858-1859 die Welt im Jahr 2858 vor:
„Die Luft, das Feuer und das Wasser, alle Elemente mit zerstörerischen Instinkten sind bezwungen worden und gehorchen gefangen unter dem Blick des Menschen all seinen Absichten. Der Himmel ist erklommen worden. Die Elektrizität trägt den Menschen auf ihren Flügeln und führt ihn in den Wolken spazieren, ihn und seine Luftschiffe. […] Ein immenses Bewässerungsnetz deckt die weiten Prärien ab, deren Schranken man abgebrannt hat und worauf zahlreiche Herden grasen, die zur Ernährung des Menschen bestimmt sind. Der Mensch thront über seine Arbeitsmaschinen, er befruchtet das Feld nicht mehr mit dem Dampf seines Körpers, sondern mit dem Schweiss der Lokomotive.“
„Der Mensch […] lässt es nach Belieben regnen oder schönes Wetter sein; er bestimmt über die Jahreszeiten und die Jahreszeiten verbeugen sich vor ihrem Meister. Die Tropenpflanzen blühen unter freiem Himmel in den Polarregionen auf; siedende Lavaströme schlängeln sich durch sie durch; die natürliche Arbeit des Planeten und die künstliche Arbeit des Menschen haben die Temperatur der Pole transformiert und dort den Frühling ausgelöst, wo zuvor der ewige Winter herrschte.“
„Der Planet [ist] zu einer einheitlichen Siedlung [geworden], die man in weniger als einem Tag erkunden kann. Die Kontinente sind die Quartiere oder Bezirke der universellen Stadt.“ Unter einer kolossalen Kuppel garantieren Zentralheizungen und Ventilatoren den Parisern „ein stets gemässigtes Klima“ und die Beherrschung der Natur weitet sich auf die Tiere aus mit „Löwen, die zu Haustieren“, und „Panthern, die wie Katzen gezähmt geworden sind“.
Die allgegenwärtigen Maschinen (das Wort Roboter wird 1920 vom Schriftsteller Karel Čapek kreiert) führen fast alle mühsamen Arbeiten aus und kümmern sich um die Hausarbeit. Dampf und Elektrizität automatisieren die meisten Bewegungen und alltäglichen Handgriffe. Nebenbei „hat“ als Folge der Harmonisierung der Menschheit „eine universelle Sprache all diese Jargons der Nationen ersetzt“.
Déjacque hatte dermassen Vertrauen in diesen unaufhaltbaren Marsch der Menschheit hin zum technischen und gesellschaftlichen Fortschritt (die bald dazu aufgerufen waren, ein und dasselbe zu sein), dass die „ökologische Frage“ für ihn im wörtlichsten Sinne undenkbar war.
Nach ihm erkannten Marx, Engels, Pannekoek, die russischen Gelehrten der 1920er Jahre und dann Bordiga allen voran ein Problem im Verhältnis zwischen der menschlichen Gattung und ihrer natürlichen Umwelt aufgrund der Bodenerschöpfung und der Verschwendung. Man ist selten intelligenter, als es die durch seine Epoche aufgeworfenen Probleme erlauben. Man kannte den Treibhauseffekt 1945, aber nicht die Schwere seiner Wirkung auf den Planeten, und man war eher bezüglich eines Atomkrieges beunruhigt.
Es gab Marx, seine Behauptungen, seine Intuitionen. Für ihn ist das Menschengeschlecht das Subjekt und die Natur der Gegenstand, ihr Gegenstand, und ihre Interaktion ändert nichts an einem Verhältnis des Vorranges, wovon Marx (und sehr wenige damals) die zerstörerische Wirkung sowohl auf die Natur als auch auf die Menschheit erkennen konnten.
Und es gab den Marxismus, für welchen die kapitalistische Produktionsweise durch den Widerspruch Produktivkräfte/Produktionsverhältnisse angetrieben und untergraben wird, erstere haben die Berufung, letztere zerplatzen zu lassen, und die Proletarier erben von den Bourgeois einen immensen technischen und wissenschaftlichen Apparat, den sie an die Bedürfnisse der Massen anpassen würden. In dieser Optik werden die Wissenschaft und die Technik meistens als gesellschaftlich neutral wahrgenommen: Der Mähdrescher und die Schreibmaschine sind Werkzeuge, alles hängt davon ab, wie und, allen voran, von wem sie benutzt werden. Wenn die Bourgeoisie einmal eliminiert ist, werden die Produktivkräfte allen zugutekommen. Im Sozialismus, schreibt Lenin, wird es das Taylor-System, heutzutage das Instrument der „Versklavung des Menschen durch die Maschine“, das es dem Arbeiter erlauben wird, viermal weniger zu arbeiten und gleichzeitig von einem viermal höheren Wohlbefinden zu profitieren. Vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen haben die Sozialdemokratie und der Stalinismus das berücksichtigt, was sie benötigten: ein (angeblich) rationales Projekt der Herrschaft über die Natur. Sie waren weit von einer Kritik des Kapitalismus entfernt und haben ihn sowohl in der Ausbeutung der Proletarier als auch in der Zerstörung der natürlichen Umwelt begleitet.
5) 20. Jahrhundert. Kritik der Ökonomie, Kritik der Ökologie
Wie jedes Gesellschaftssystem muss sich der Kapitalismus nicht nur legitimieren, sondern er muss auch über sich selbst und seine Widersprüche nachdenken: Die Wirtschaftswissenschaften sind eines seiner privilegierten Mittel des Selbstverständnisses.
In der griechischen Antike beschrieb die „Ökonomie“ die Verwaltung „des Hauses“, d.h. des Landgutes, in einer Gesellschaft der Landeigentümer, die mit anderen manchmal weit entfernten Regionen handelten, in welcher jedoch das Land die wesentliche Quelle des Reichtums blieb.
Mit der Industriellen Revolution nahm die „Ökonomie“ den allgemeinen Sinn der Produktion und des Vertriebs von Gütern und Dienstleistungen an und die ökonomische Fachkenntnis hat sich als jene aufgedrängt, welche es erlaubt, eine von Fabriken, Frachtschiffen und Waren, d.h. von Kapital und Lohnarbeit gesättigte Welt zu verstehen und zu verwalten. Während man 1960 in einem französischen Gymnasium nicht „die Ökonomie“ unterrichtete, ist jede politische Diskussion heutzutage von einem Schwall an Statistiken über das „Wachstum“ oder die Beschäftigung begleitet. Die Allgegenwart der „Ökonomie“ ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Parallel dazu konnte der planetarische Aufstieg des die für ihn notwendigen Gleichgewichte auf den Kopf stellenden Kapitalismus zwangsläufig „die Natur“ (im weiteren Sinne, der sowohl den Wald als auch die Temperatur enthält) nicht mehr als unendlich verfügbares und ausbeutbares Gut betrachten.
Die „Ökonomie“ als Wissen – und Weltanschauung – reichte nicht mehr: Es musste über die Beziehungen zwischen der (im vorliegenden Fall kapitalistischen) Gesellschaft und dem, was ihre Existenz konditioniert, nachgedacht werden.
Der Erfinder des Worts und des Begriffes der „Ökologie“ 1866, der deutsche Biologe Ernst Haeckel, ein anerkannter Gelehrter, populärwissenschaftlicher Autor und bekannt dafür, die Lehre Darwins verbreitet zu haben, interessierte sich mehr für die Evolution der Arten als für die historische Evolution. Trotzdem zeugte seine Forschung von der Notwendigkeit, eine unumgängliche Realität zu berücksichtigen: die Gesamtheit der materiellen Grundlage, auf welcher die menschliche Tätigkeit basiert. Es war freilich noch kein Bewusstsein für eine bedrohte Umwelt. Aber Haeckel hatte schon einen ganz anderen Blick auf die Welt als vor ihm Descartes („uns zum Herrscher und Besitzer der Natur zu machen“) oder Francis Bacon (experimentell Kenntnisse über die Natur zu erlangen, um sie in den Dienst des Menschen zu stellen). Für Haeckel lebt und entwickelt sich die Menschheit innerhalb einer Totalität lebender Wesen: Das Feld der „Ökologie“ hat sich danach auf den ganzen Planeten ausgeweitet.
Ökonomie und Ökologie sind also zwei sehr verschiedene Dinge. Im Gegensatz zur Ökonomie, die sich die Frage stellt, wie „das Haus“ produktiv verwaltet werden kann, will die Ökologie viel mehr als eine Wissenschaft der Verwaltung sein: Sie bringt die Gesellschaften in ihre globale Umwelt zurück, vereinigt „Humanwissenschaften“ und „Naturwissenschaften“ und strebt nach der Schnittmenge zwischen Geschichte, Biologie, Geographie, Klimatologie…
Aber das Wissen der Gelehrten und der „breiten Öffentlichkeit“ geht nicht über das hinaus, was denkbar ist in jener Gesellschaft, welche es hervorruft und unterhält. In Tat und Wahrheit denkt die Ökologie die Welt, ohne des Pudels Kern seit zwei Jahrhunderten zu berücksichtigen: das Verhältnis Kapital/Arbeit, die Beziehung Bourgeois/Proletarier. In den Augen jener, welche sich als Umweltschützer präsentieren, scheint die Analyse der Gesellschaft in Klassenbegriffen sekundär, illusorisch oder überholt. So erklärt ein jüngst erschienenes Buch, das sonst reich und stimulierend ist, die Geschichte der Energieträger im Industriezeitalter durch die Herrschaft „der Technologie“, „der technischen [und] produktivistischen Vorstellungskraft“, eines „produktivistischen Systems“, „eines techno-ökonomischen Imperialismus“ und „der technischen Macht“ (François Jarrigue & Alexis Vrignon). Man könnte sagen, der Kapitalismus – der unsichtbar gemacht worden ist.
Trotz ihrer Ambition, „die Wissenschaft der Existenzbedingungen“ (Haeckel) bereitzustellen, hat sich die Ökologie seit einigen Jahrzehnten als eine Wissenschaft und Technik entwickelt, welche die Exzesse der kapitalistischen Produktionsweise reparieren soll. Genau wie die weitsichtigsten Ökonomen (Keynes) machen die Umweltschützer auf die Effekte eines Systems aufmerksam, dessen tiefe Ursachen ihnen entgehen. In der Praxis sind die „Ökonomie“ und die „Ökologie“ eher komplementär denn Rivalinnen: Der „ökologischen Ökonomie“ geht es gut, die meisten Umweltschützer denken in ökonomischen Kategorien und die Debatten drehen sich um die beste oder am wenigsten schlechte Art und Weise, die Ökonomie durch die Ökologie zu kompensieren, indem die negativen Auswirkungen einer Produktion (und eines Konsums) reduziert werden, die sonst ihre eigenen Grundlagen zerstören würden. Wie? Indem (gemäss den Denkschulen variable) Dosen Ökologie in die Ökonomie injiziert werden.
Für uns wird es also nicht darum gehen, die Ökonomie mit der Ökologie zu komplettieren oder erstere durch letztere zu korrigieren, sondern sowohl die eine als auch die andere zu kritisieren.
G. D., Oktober 2020
Literaturverzeichnis
Jérémie Cravatte, L’Effondrement, parlons-en… Les Limites de la collapsologie, 2019.
Elizabeth Kolbert, Das sechste Sterben. Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt, Berlin, Suhrkamp, 2015 [2014].
Charles Fourier, Die Freiheit in der Liebe, Hamburg, Nautilus, 2017 [1967].
René Schérer, L’Écosophie de Charles Fourier. Deux textes inédits, Economica, 2002 (einer davon ist „Détérioration matérielle de la planète“).
Marx zum „Riss des Stoffwechsels“: Das Kapital, Bd. 3 in MEW, Bd. 25, S. 821.
Zur Bedeutung des Grundeigentums: Fragment „Die Klassen“ in Das Kapital, Bd. 3 in MEW, Bd. 25, S. 892-893.
Theoretiker, die Marx als (prä-)ökologisch darstellen:
John Bellamy Foster, The Ecological Revolution. Making Peace with the Planet, New York, The Monthly Review Press, 2009.
Paul Burkett, Marx and Nature: A Red and Green Perspective, 1999. Die neue Ausgabe von 2014 enthält eine Einleitung von John Bellamy Foster.
Wir werden im Kapitel 7 auf diesen Autoren zurückkommen.
Anton Pannekoek, „Naturverwüstung“, 1909; Antropogenese. Een studie over het ontstaan van de mens, 1944.
Amadeo Bordiga, Espèce humaine et croûte terrestre, Payot, 1978. Artikelsammlung, einige davon sind online verfügbar:
"Specie umana e crosta terrestre“, Il Programma Comunista, Nr. 6, Dezember 1952.
„Spazio contro cemento“, Il Programma Comunista, Nr. 1, 1953.
„Piena e rotta della civiltà borghese“, Battaglia Comunista, 8. Dezember 1951.
„Politica e ‚costruzione‘“, Prometeo, zweite Reihe, Nr. 3-4, Juli 1952.
Seine Texte zur Landwirtschaft, 1954.
Jean Batou, „Révolution russe et écologie (1917-1934)“, Vingtième Siècle, Nr. 35, Juli-September 1992, S. 16-28.
Die bolschewistische Absicht, die Natur zur Entwicklung der Produktivkräfte auszubeuten, vermeintlich zugunsten aller, ging mit einem biopolitischen Versuch einher, genau so „rational“ die Gesetze der Geschichte auf die Sitten und Gebräuche anzuwenden, besonders im Bereich der Sexualität. Siehe „‘Cher Camarade Staline‘. Homo au pays des soviets“.
Joseph Déjacque, L’Humanisphère, utopie anarchiste, 1858-1859.
Zu seinem Projekt gehören gemeinsam organisierte Arbeit, die Ersetzung des Geldes durch ein System der Gutscheine, „eine Bank für gegenseitige Kredite“ und „die Abschaffung jeglicher Form des Wuchers“. Er ist der erste oder einer der ersten, der von „Übergangsphase“ spricht. Hier findet man eine kurze Bibliographie und einige Auszüge.
Lenin, „Das Taylor-System – die Versklavung des Menschen durch die Maschine“, 1914.
François Jarrigue & Alexis Vrignon, Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel, La Découverte, 2020.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 02: Der Kapitalismus wird nicht ökologisch sein
Im zeitgenössischen politischen Diskurs ist die Ökologie allgegenwärtig geworden: Energiewende, grüner Kapitalismus, ökofreundlicher Reformismus… Doch grundlegend ändert sich nichts, die geringen erreichten Fortschritte verschieben die kommenden Gefahren kaum, denn die Unvereinbarkeit zwischen Ökologie und Kapitalismus ergibt sich nicht aus der Blindheit oder der Habgier seiner Anführer: Es ist viel einfacher, sie ergibt sich aus dem Wesen eines solchen Systems.
1) Unvermeidbare Masslosigkeit
Die als industriell oder heute postindustriell bezeichnete moderne Gesellschaft besteht aus Unternehmen, jedes davon ist ein nach Wachstum strebender Wertpol, der sich die Industriesysteme zu Diensten macht. Der Forscher kann sich für die Entdeckung eines neuen Produktionsverfahrens begeistern und der Ingenieur mit viel Liebe einen Staudamm bauen, aber ihre Projekte werden nur Wirklichkeit, wenn sie dem Interesse der sie anstellenden Unternehmen entsprechen: ein kompetitives Produkt auf dem Markt verkaufen, Gewinne akkumulieren, sie neu investieren…
„Außerdem macht die Entwicklung der kapitalistischen Produktion eine fortwährende Steigerung des in einem industriellen Unternehmen angelegten Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver Akkumulation. […] Akkumulation um der Akkumulation, Produktion um der Produktion willen, in dieser Formel sprach die klassische Ökonomie den historischen Beruf der Bourgeoisperiode aus.“ [11]
Der Beweis dafür, dass wir allen voran in einer kapitalistischen und nicht in einer industriellen Welt leben, ist die Tatsache, dass die industrielle Hypertrophie, die alles andere als ein autonomes Phänomen ist, den Zwängen der Kapitalverwertung unterworfen ist. Es ist unbedeutend, ob eine Autofabrik, eine Mine oder ein Stahlwerk noch in einem funktionalen Zustand ist: Wenn etwas nicht rentabel genug ist, wird es geschlossen. Der Bourgeois darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und ein gleich bleibender Kapitalismus ist ein Zeichen des Niedergangs. Seit zweihundert Jahren erneuert sich „die Megamaschine“ regelmässig durch Aufbau, Selbstzerstörung, Wiederaufbau… Man kennt das Schicksal des amerikanischen Rust Belt, das übrigens nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Industrie in diesen Regionen ist, es kommen immer noch 40% der Fertigwaren des Landes von dort. Techniken, Produktionssysteme und Fabrikationsstandorte ersetzen andere, die gegenüber der Konkurrenz weniger leistungsfähig sind. Schwer aufgrund seines unvermeidlichen materiellen Gewichts ist der Kapitalismus in seinen Träumen finanziell, virtuell, digital mit Nullen und Einsen, doch er würde nicht ohne Proletarier existieren, die Hunderte von Millionen Tonnen an Erz, Holz, Blei, Zement, Plastik transformieren – die unverzichtbar für die Produktion jener Bildschirme sind, auf welchen die Kreditlinien vorbeihuschen.
Die Verringerung der Produktionskosten ist eine permanente bürgerliche Priorität: durch die Intensivierung der Arbeit der Proletarier und, falls notwendig, durch die Aufzehrung der materiellen Produktionsgrundlagen. Als unermüdlicher Erschaffer und Zerstörer, Verzehrer von Ressourcen und seit jeher Verschmutzer kennt der Kapitalismus die Nüchternheit definitionsgemäss nicht. Schon gegen 1800 ertrugen die Arbeiter und Anwohner die für ihre Gesundheit schädliche Giftigkeit der Manufakturen. Seither hat sich das Niveau der Schädlichkeit verändert.
Ob sparsam oder verschwenderisch ist der Bourgeois nicht zwingend um seiner selbst willen profitgierig, aber er dient dieser Logik. Der einzige „vernünftige“ Profit ist jener, welcher sein Unternehmen begünstigt. Die besten sozialen oder ökologischen Absichten des gutmütigsten Kapitalisten bleiben sekundär, wenn die Konkurrenz tobt.
„Wachstum“ ist der Name, welcher „der Fortschritt“ annimmt, wenn er auf die Ökonomie angewandt wird. Von James Watts Dampfmaschine bis zur Elektronik des Silicon Valley ist der Glaube an den Fortschritt für die Bourgeoisie und für jene, die in ihrem Kielwasser schwimmen, wesentlich und notwendig, doch er wird erst zu einer materiellen Kraft, wenn er eine Einheit mit dem Imperativ der Wertakkumulation bildet.
2) Eine Welt der Unternehmen
Die kapitalistische Produktionsweise entwickelt nicht nur mit einem unglaublichen Tempo ein zerstörerisches industrielles System, sondern sie wird sich auch immer dagegen sträuben, für ihre Verheerungen die Verantwortung zu übernehmen.
Die von uns bewohnte Welt kann nicht wie ein einheitliches Unternehmen verwaltet werden, das sich um die Administration der gesamten Erde und einer planetarischen Umwelt kümmern müsste, ein einziges, von nun an über das Erbe der Menschheit herrschendes Kapital.
Diese globale Multinationale ist eine Utopie. Nach 1914-1918 ist Bucharin nicht der einzige, der die (gemäss ihm unwahrscheinliche) Hypothese „ein[es] vom Standpunkt des Kapitals rationelle[n] Plan[s]“ vorgebracht hat, der von einer vereinigten kapitalistischen Klasse verwirklicht werden würde. Was auch die ohnehin unüberwindbaren geopolitischen Hindernisse dafür sein mögen, macht die Logik der kapitalistischen Produktionsweise einen solchen einheitlichen „Trust“ strukturell unmöglich. Wer (Binnen- oder Welt-)Markt sagt, sagt Konkurrenz.
Als nach seiner eigenen Verwertung strebender Wertpol ist jedes Unternehmen nur für sich selbst und seine Bilanz verantwortlich. Es funktioniert wie ein Organismus mit einer Innenseite, die sich von der Aussenseite unterscheidet, aber porös ist, und es lebt von dieser Porosität. Es gehen Investition, Rohstoffe, Lohnarbeiter, technische Installationen herein. Und es kommen Waren heraus, die Geld generieren, welches das Unternehmen integriert und akkumuliert. Mit dem Rest der Gesellschaft ist es selbstverständlich in permanentem Kontakt, doch, da es nur für seine Inputs und Outputs verantwortlich ist, schuldet es niemandem in seinem Umfeld Rechenschaft. Es muss bloss das Gesetz respektieren (besonders das Arbeitsrecht – das gab es nicht immer und in vielen Ländern existiert es nur auf dem Papier) und Steuern zahlen (die es normalerweise auf ein Minimum zu reduzieren versucht). Wenn diese beiden Bedingungen einmal erfüllt sind, geht es den Rest nichts mehr an: „Ich schulde der Öffentlichkeit nichts“, proklamierte im 19. Jahrhundert der amerikanische Grossbourgeois J.-P. Morgan. Der Chef sorgt sich nur insofern um die Gesundheit des Lohnarbeiters und seiner Familie und seine Altersvorsorge, als dass es einen Einfluss auf die Produktivität und die künftige Generation der Arbeiter hat. Das Unternehmen muss sich auch nicht, solange es nicht rechtlich relevant ist, darüber sorgen, welche negative Auswirkungen es ausserhalb seiner Mauern hat.
Damit diese „externen Kosten“ berücksichtigt werden, war es notwendig, dass die kapitalistische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit unter den durch jedes Unternehmen an seiner Umwelt verursachten Schäden zu leiden beginnt. Es wurde zu einer Dringlichkeit, die Kosten der zur Begrenzung der Erwärmung notwendigen Investitionen mit den eventuellen Kosten der erlittenen Verluste im Falle der Passivität zu vergleichen. Doch die Unternehmen streben bloss danach, eine Schwelle der Reduktion der CO2-Emissionen zu erreichen, die, wie es ein Experte einräumt, „wirtschaftlich optimal“ ist.
Die Bourgeoisie ist weder monolithisch noch blind und es fehlt ihr nicht an Thinktanks, um ihr in der Konfrontation mit ihren Konflikten und Widersprüchen beizustehen. Sie hat jedoch äusserst grosse Schwierigkeiten, hinsichtlich eines kollektiven „Klasseninteresses“ zu handeln, wie es die Mühe zeigt, die Roosevelt hatte, um den New Deal durchzusetzen: Dafür spielt der Staat eine unverzichtbare Rolle, doch er befiehlt nicht, er reglementiert und reguliert nur. Obwohl drastische Massnahmen im Kampf gegen das Klimaproblem allen Bourgeois zugutekämen, wird sich jedes Unternehmen dagegen sträuben, seine (direkten oder fiskalischen) Produktionskosten für einen Nutzen zu erhöhen, der allen voran für die Gesamtheit der kapitalistischen Klasse einer wäre. Individueller Profit (das Individuum ist hier erst einmal das Unternehmen) und bürgerliche Kooperation passen selten gut zueinander: So ökologisch er auch sein mag, ein Chef kann es nicht riskieren, seine Kompetivität zu reduzieren.
3) Finstere Zukunft
Das Volumen der internationalen Schiffsfracht multipliziert mit vier bis 2050, Verdoppelung des Luftverkehrs in den nächsten Jahrzehnten („Covid-Effekt“ ausgenommen, aber der ist heute schwierig einzuschätzen), Explosion des Tourismus, Steigerung von 100% der globalen Kleiderproduktion seit 2000 (um den Preis eines enormen Wasserverbrauches und des massiven Einsatzes von Pestiziden), konstante Zunahme des Plastiks, Verbreitung von 5G, das sehr viel Energie konsumiert – die Liste des schädlichen Wachstums ist unendlich. Die Digitaltechnik erfordert Metalle, die mittels einer Industrie transformiert werden, die sehr durstig nach Energie ist, ihre Nutzung absorbiert zwischen 7 und 10% der weltweiten Elektrizität (die Zahlen variieren, doch die Steigerung beschleunigt sich) und es scheint erwiesen, dass die Informationstechnologien einen nicht geringeren Einfluss auf den Klimawandel haben als der Flugverkehr. „Hinsichtlich Zerstörung haben wir noch nichts gesehen.“ [12] Und die Covid-19-Krise wird an dieser Tendenz nichts ändern.
Die Elektromobilität wird zu neuen Komplikationen und keiner Erleichterung in der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und ihren Folgen führen, sei es nur durch ein zunehmendes Zurückgreifen auf seltene Metalle, deren Extraktion und Raffination sehr verschmutzende Prozesse erfordert. Was soll‘s! Das „Benzin- oder Dieselfahrzeug“ ist obsolet, die Entwicklung hin zum elektrischen Betrieb scheint gesichert und Irland brüstet sich mit der Erreichung der „Kohlenstoffneutralität“ im Jahr 2050 dank ein oder zwei Millionen Elektroautos. Alles hängt davon ab, wie man zählt: Wenn man die Totalität des Ausstosses von Treibhausgasen vor der Produktion und nach der Nutzung nicht berücksichtigt, ist der Fahrer eines Tesla berechtigt, sich ökologisch zu nennen.
Die Fortbewegung ist eine Notwendigkeit und ein Vergnügen für den Menschen, doch der Kapitalismus macht aus der Mobilität ein spezifisches Bedürfnis und Konzept. Alles muss zirkulieren, in der Produktion und ausserhalb von ihr, bei der Arbeit und ausserhalb von ihr. Die individuelle Mobilität, das bedeutet, „meine“ Musik jederzeit hören zu können, beim Laufen auf der Strasse, im Bus, beim Warten auf einen Freund – dank einem tragbaren Apparat, der sich mit mir fortbewegt. Es ist auch die Freiheit, in einem individuellen Fahrzeug zu fahren: Eine Gesellschaft von in Familien (die sich natürlich von jenen damals unterscheiden) organisierten Individuen privilegiert das individuelle oder Familienfahrzeug. Mit oder ohne „Nullemissionsbus“.
Die Nachhaltigkeit widerspricht einer Obsoleszenz, die Teil der Funktionsweise und des Gebrauchs der Gegenstände ist, besonders der elektronischen. Wiederverwertung, Teilen, Zugang ohne Eigentum, Recycling, Genossenschaftswerkstätten, Tausch usw. werden von Leuten verteidigt, die in der Regel kein Problem mit der Durchsetzung „der Glasfaser“ haben. Auf 4G muss ein fünftes folgen, es ist unerlässlich für die Welle der in Netzwerken miteinander verbundenen Kommunikationsobjekten, des cloud computing, in der domotisierten Umwelt einer „intelligenten“ Stadt. In der Zwischenzeit warten wir auf 6G. Und jene, welche diese Entwicklung kritisieren, tun es allen voran aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit oder ihrer ökologischen Kosten, selten wegen der Gründe ihres Gebrauchs, des von ihr erfüllten und unterhaltenen Bedürfnisses: Mit allen jederzeit innerhalb einer Sekunde verbunden zu sein. Eine Technologie, die dem Bedürfnis der Sozialisierung eines „modernen Menschen“ entspricht, der so individualisiert ist wie nie zuvor.
Folglich glaubt niemand ernsthaft, dass in den nächsten Jahrzehnten eine um die Hälfte oder ein Drittel reduzierte Flotte von Containerschiffen fünf- oder zehnmal weniger iPhones, Corrolas, Playmobil und Nikes als heute transportieren wird. Die vermeintliche oder erwiesene höhere Produktivität der Windkraftwerke im Vergleich zu den Atomkraftwerken verhindert die Entwicklung der Infrastrukturen für fossile Energie, den Bau neuer Pipelines, Umgehungsstrassen und Autobahnen hier und dort nicht, auch nicht jener von Kohlekraftwerken, genauso wenig wie sie die zunehmende Plastikproduktion bremst, dessen Konsum sich in fünfzehn Jahren verdoppelt hat und der mehrheitlich ein Produkt der Petrochemie ist. Wenn auch, wie es wahrscheinlich ist, die Sonnen- und Windkraft in einigen Jahren günstiger werden als die fossilen Brennstoffe, ändert der unleugbare Aufstieg des Marktes der erneuerbaren Energien kaum etwas an der Klimasituation.
Zwischen „der Eingrenzung“ (die Hoffnung, die Erwärmung spürbar zu bremsen) und der Anpassung an eine Zukunft, auf deren Beeinflussung man verzichtet, ist die zweite Option prioritär.
Die herrschende Klasse ist unfähig, die Zukunft vorzubereiten – sogar ihre eigene –, weder kurz- noch langfristig. Roosevelt fand – auf seine Art und Weise, aber es gab auch andere – Antworten auf die Probleme seiner Zeit, im besten Falle mit einem Horizont von zwei Jahrzehnten, doch weder 1932 noch 1944 befasste er sich mit dem Jahr 2000 oder 2050. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts, unvorhersehbar für Marx 1883 wie auch für Rosa Luxemburg 1919, zeigt, dass die Bourgeoisies der verschiedenen Länder nie die Zukunft antizipierten, weder ihre technischen und gesellschaftlichen Fortschritte, noch ihre Katastrophen. Krieg 1914, Krise 1929, Nazismus, Krieg 1939-1945, Stalinismus – all das wurde und wird immer noch von herrschenden Denkern vergangenen Irrungen, dem Versagen, Widersinnigkeiten, Krankheiten der Menschheit, gewissermassen, zugeschrieben, und nicht dem mutmasslich stets verbesserungsfähigen Wesen des Kapitalismus. Das gleiche gilt in Anbetracht der Klimakrise.
4) Welche Krise?
„Obwohl der Kapitalismus nach 1980 tatsächlich einen neuen Aufschwung erlebte, war sein Sieg nicht das, was man glaubt. Die aktuelle Krise zeigt, dass der Boom am Ende des Jahrhunderts keine Antwort auf die Probleme der 1970er Jahre lieferte: Überkapazität, Überproduktion, Überakkumulation und Fall der Rentabilität. Die Produktivitätsgewinne stiegen in den 1990er Jahren dank der Digitalisierung, der Eliminierung der wenig rentablen Industriesektoren und der Investition in Fabriken mit tiefen Arbeitskosten in Asien wieder an, besonders in den USA. Aber, obwohl es die Allianz zwischen Computer und Container schafft, die Arbeit zu komprimieren und zu transferieren, berührt sie den Fall der Profite nur oberflächlich. Die Schwächen der 1970er Jahre sind vierzig Jahre später immer noch präsent, sie werden kaschiert durch die Profite einer Minderheit von Firmen (die man früher als Monopole oder Oligopole qualifiziert hätte) und des Finanzsektors.“ Das schrieben wir 2017 [13].
In dieser allgemeinen Situation eines Rentabilitätsdefizits würden die für „die Eingrenzung“ unvermeidlichen Investitionen, wenn man davon ausgeht, dass sie getätigt werden, die gegenwärtige Krise verschlimmern, trotz den Gewinnen für einen Teil der Bourgeoisie. Die auf dem Spiel stehenden Beträge wären unvergleichbar mit jenen, welche 2008 zur Unterstützung der Banken mobilisiert wurden.
„Tausend Milliarden für das Klima“, empfehlen Jean Jouzel und Pierre Larrouturou [14], sie wollen aufzeigen, dass eine notwendige grüne Politik nicht nur möglich, sondern sozial günstig (eine Million neue Arbeitsplätze, Verbesserung der öffentlichen Dienste) und, noch ein Vorteil, gut für die Wirtschaft und die Kompetivität des Landes – und Europas – wäre.
Damit traut man der kapitalistischen Produktionsweise mehr zu, als sie tun will und kann. In naher Zukunft wird es nicht mehr grünen denn sozialen Keynesianismus geben. Erwarten wir nicht eine Mobilisierung aller Ressourcen wie jene der USA nach Pearl Harbor, als ein enormer Anteil des Budgets die Aufrüstung finanzierte, der Bundesstaat verwaltete die Produktion von Flugzeugen und Munition, requirierte private Güter und erlegte dem Kapital und der Arbeit Verträge auf. In weniger als einem Jahr war die Industrie wie nie zuvor umorientiert, Chrysler stellte Flugzeugrümpfe her, Ford Bombenflugzeuge, General Motors Panzer usw. Die Reduktion von 5 oder 10% der Treibhausgase pro Jahr würde eine unvergleichbare Bemühung voraussetzen, eine Zentralisierung der Entscheidungsgewalt, ein „Ministerium für einen Übergang hin zu einer Zukunft mit geringer Kohleintensität“, die „eine Planwirtschaft für Energie“ [15] verwalten würde, die, darüber hinaus, den nationalen Rahmen übersteigen würde, sonst wäre sie ineffizient. Es genügt, diese Bedingungen aufzuzählen, um festzustellen, dass sie nicht verwirklichbar sind. Die Alliierten mobilisierten 1941 gegen Deutschland und Japan. Nach Pearl Harbor war es für das amerikanische Big Business inakzeptabel, den Japanern die Kontrolle über den Pazifik und Territorien mit wertvollen wirtschaftlichen und mineralischen Ressourcen zu überlassen. Die Bedrohung war präzis und ihre Folgen unmittelbar konkret.
Achtzig Jahre später wird der amerikanische, europäische, chinesische oder „globalisierte“ Kapitalismus dem CO2 nicht den Krieg erklären. Die kapitalistische Ökonomie funktioniert zur Befriedigung des Kapitalertrags: Der „Klimanotstand“ ist für sie nicht dringender als die Arbeitsbeschaffung für Millionen von Arbeitslosen.
Auf der anderen Seite des Atlantiks kämpft eine Strömung der Demokratischen Partei, die für diverse Nichtregierungsorganisationen spricht, für einen Green New Deal und verlangt, dass die USA bis 2030 ein Stromnetz aufbauen, das zu 100% dank erneuerbarer Energien funktioniert, und in grossem Stil grüne Infrastrukturen bauen. Dieser „neue“ New Deal vergisst, dass es den Druck der Krise von 1929 und eine Streikwelle mit Fabrikbesetzungen brauchte, um Roosevelt die Mittel zu geben, der Bourgeoisie gewisse Zwänge aufzuerlegen: die Beschränkung des Gewichts der Finanz und die Akzeptanz gewerkschaftlicher Präsenz in den Unternehmen. Doch man wird die Kapitalisten nicht dazu zwingen können, in Anbetracht der Konkurrenz auf die maximale Produktivität zu verzichten, denn hier geht es nicht mehr um das (verhandelbare) Verhältnis zwischen Lohn und Profit, sondern um die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Eine „Ökologisierung“ der Welt ist politisch unmöglich, weil sie nicht rentabel wäre. Freilich wird in den USA und anderswo ein Teil dieser grossen Programme umgesetzt werden. Aber werden es die Klimabewussten viel besser machen als die Klimaskeptiker à la Trump? Man sucht vergeblich nach der ambitiösen grünen Politik Obamas, der es 2014 begrüsste, dass sein Land zum weltweiten führenden Erdölproduzent geworden war.
* * *
Es ist legitim, die Frage zu stellen, welche bürgerlichen „Fraktionen“ ein Interesse an einem grünen Kapitalismus haben: Die Erdölfraktion wiegt immer noch schwer; andere Sektoren, die von einem „grünen Kapitalismus“ abhängig sind, befinden sich auf einem aufsteigenden Ast. Die Frage ist jedoch nicht, wann die kapitalistische Produktionsweise damit aufhören wird, den natürlichen Gleichgewichten zu schaden – sie ist dazu unfähig –, sondern ob sie das für den Fortbestand der Bourgeoisie notwendige gesellschaftliche und politische Gleichgewicht aufrechterhalten oder wieder herstellen wird.
G. D., November 2020
Literaturverzeichnis
Marx, Das Kapital, Bd. 1, 22. Kap., § 3.
Andreas Malm, „Capital fossile: vers une autre histoire du changement climatique“.
Sehr dokumentierter Artikel. Unsere Episode 05 wird auf Malm und seine These eines „fossilen Kapitalismus“ zurückkommen.
Philippe Bihouix, Le Bonheur était pour demain, Seuil, 2019.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 03: Die Ökologie – und die Bourgeoisie
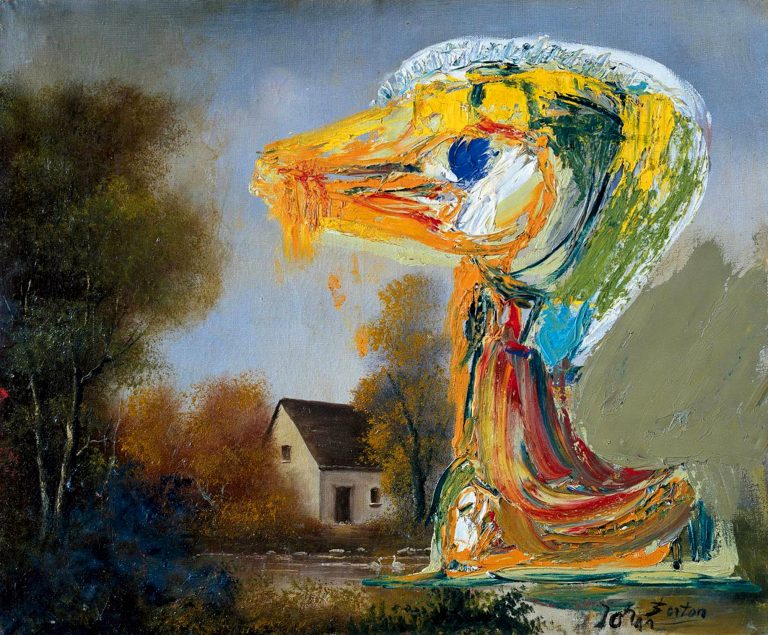
Obwohl eine Minderheit der politischen Anführer dieser Welt ihre „Klimaskepsis“ zur Schau tragen, verstehen sich die meisten als ökologisch: in der UNO, im Vatikan, in Davos, an der Universität genau wie in den rechten Medien – und sogar bei einigen Tendenzen der extremen Rechten – in der extremen Linken – alle sind sie ökologisch. Die Ökologie gehört zur herrschenden Ideologie im 21. Jahrhundert.
1) Whistleblower und Konsens
Westeuropa hatte 1961 einen Organismus ins Leben gerufen, der mit der Förderung des Marktes, der Produktivität und des Liberalismus beauftragt war und dem sich danach die USA und Japan angeschlossen haben: die OECD.
Der vom Club of Rome in Auftrag gegebene „Meadows-Bericht“, der ein breites Spektrum der wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Eliten des Westens repräsentierte, hob 1972 deutlich die Folgen einer zunehmenden (und unvermeidlichen) Diskrepanz zwischen demographischem Wachstum und Abnahme verfügbarer Ressourcen hervor. Die Grenzen des Wachstums war ein weltweiter Bestseller.
Die Gründung eines ökologischen Reflexionsorgans 1988, des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), markiert einen Perspektivenwechsel. Die prioritäre Befürchtung ist nicht mehr der Mangel an (besonders fossilen) Ressourcen, sondern die Tatsache, dass man zu viel abbaut und die für die Natur genau wie für den Fortbestand der kapitalistischen Welt notwendigen Gleichgewichte gefährdet.
Nicholas Stern, ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, warnte 2006: „Wenn die Individuen nicht für die Folgen ihrer Handlungen bezahlen, haben wir es mit einem Marktversagen zu tun.“ Es wäre notwendig, dass die Unternehmen und jeder von uns jetzt ein bisschen mehr bezahlen, um nicht bald viel mehr bezahlen zu müssen: Stern schätzte die Kosten der Passivität gegenüber dem Klimawandel auf zwischen 5 und 20% des jährlichen weltweiten BIP, statt nur 1% wenn wir heute reagieren.
Wie jene der vorhergehenden Berichte sind die Berechnungen von Stern umstritten, aber die Bourgeoisie hat den Denkzettel zur Kenntnis genommen. Das Big Business ist nicht mehr blind in Anbetracht einer Klimakrise, die es mit einem neuen Wachstum zu regeln hofft, das sich von jenem der „dreissig glorreichen Jahre“ unterscheidet, da es „ökoverantwortlich“ wäre, die Technologie von morgen soll die Schäden von jener von gestern beheben. Die Bourgeois geben zu, dass die kapitalistische Produktionsweise ein Problem darstellt – unter der Bedingung, dass sie auch als die Lösung betrachtet wird.
2) Kommodifizieren um zu schützen
Sterns Argumentation entspricht der kapitalistischen Logik: Die Unternehmen stossen Kohlenstoff aus, weil es sie nichts oder zu wenig kostet, sorgen wir also dafür, dass sie verhältnismässig dafür bezahlen müssen, und sie werden viel weniger davon ausstossen.
Alles wie gehabt: Wenn die Kommodifizierung der Welt dazu tendiert, alles zu umfassen, kann sich der (heilende oder präventive) Kampf gegen die Verschmutzung ihr nicht entziehen. Der Kapitalismus macht aus fast allem einen Profit: Die Entgiftung ist die Antwort auf ein zahlungskräftiges Bedürfnis, wird zu einer rentablen Aktivität und Reformer wie Stern beurteilen es als logisch und vernünftig, aus dem „Recht auf Verschmutzung“ eine Ware im Rahmen der „Kohlenstoffbörse“ zu machen. In der Praxis erhält oder kauft jedes Unternehmen austauschbare Quoten: Wenn es seine Emissionen reduziert, kann es seinen Quotenüberschuss anderen Unternehmen verkaufen.
Nach dem gleichen Modell spielt man mit dem Gedanken, jeden von uns mit einer „Kohlenstoffkarte“ auszustatten (heute freiwillig, morgen obligatorisch), die jedem eine individuelle jährliche Kreditquote einräumt, von der bei gewissen Einkäufen abgezogen wird, hier auch mit der Möglichkeit, die ausgegebenen oder eingesparten Kredite zu kaufen oder verkaufen. Die Verschmutzung würde monetarisiert werden und ihre negative Auswirkung in öffentlichen oder privaten Buchhaltungen eingetragen, wie es schon in den Bilanzen der Unternehmen der Fall ist.
Von Anfang an strebte die kapitalistische Produktionsweise nach jener „nachhaltigen Entwicklung“, die ihr entspricht, und ihre natürliche Neigung ist es, die Fehler des Marktes durch den Markt selbst zu korrigieren: Heutzutage wird das Unternehmen durch Besteuerung tugendhaft gemacht, wenn es zu viel Kohlenstoff produziert, oder belohnt, wenn es wenig genug davon produziert. Der Kapitalismus ist und wird „wirtschaftlich“ sein, wie er es immer war. Wenn die Europäische Union den Erfolg ihres „Emissionshandelssystems“ anpreist und für 2020 eine Reduktion von 21% der Kohlenstoffemissionen durch die 31 betroffenen Länder im Vergleich zu 2005 ankündigt, ist die Zahl wahrscheinlich anfechtbar, nicht aber die Realität eines gewissen „Fortschrittes“. Doch wenn sich weltweit betrachtet der Treibhauseffekt verstärkt, dann sind diese Fortschritte dem Problem nicht gewachsen.
3) Wie viel ist ein Ozean wert?
Die systematische Quantifizierung ergibt sich aus dem Produktivitätsimperativ. Führungskräfte von Google erklären, dass sie ihr Unternehmen „auf der Wissenschaft der Vermessung“ gegründet haben und sich anstrengen, „alles zu quantifizieren“. Was neu daran ist, ist die Tatsache, dass bis anhin vernachlässigte Parameter in finanzielle Rentabilitätsberechnungen einbezogen werden, menschliche, natürliche und sogar soziale Faktoren, aber auch sie reduziert auf Zahlen. Im Kapitalismus ist es logischerweise zu ihrem Schutz das beste Mittel, den Ozeanen einen Marktwert zu geben, indem ihre Ressourcen rational ausgebeutet werden, ohne sie aufzubrauchen. Wenn der World Wildlife Fund die „ozeanische Schatzkammer“ auf 24‘000 Milliarden Dollar schätzt und bekräftigt, dass ein Bruttomeeresprodukt, das nach dem Modell der nationalen BIP berechnet wird, aus den Ozeanen die siebte Weltwirtschaft mit einer jährlichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen von 2‘500 Milliarden machen würde (das französische BIP war ungefähr 2‘800 Milliarden 2018), ist das jene Art von Diskurs, den die Kapitalisten verstehen. Es würde genügen, die Lagunen, Wälder, Korallenriffe oder Mangroven als Produktionsfaktoren zu zählen, und sie in die buchhalterischen Kosten der Unternehmen und Staaten zu integrieren, um ihre Einsparung obligatorisch zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern dieser Diskurs Realität wird.
Die Quantifizierung des Qualitativen, das ist die kapitalistische Produktionsweise und das ist „der Wert“: Alles wird auf ein gemeinsames Element, auf eine gemeinsame Angabe reduziert, sie ist messbar da gemeinsam. Was nicht gezählt werden kann, zählt nicht, und was im Gegenteil gemessen werden kann, verbessert sich, erklärt uns ein Berater in einem Artikel, von dem man uns in Kenntnis setzt, dass er in drei Minuten gelesen werden kann. Alles muss also auf ein zählbares Verhältnis Kosten/Gewinn reduziert werden können. Bhutan misst das Bruttonationalglück; die UNO die world happiness; und der Tod misst sich in Dollar. Die Weltbank und die Wiederversicherer sind alarmiert aufgrund der durch den Klimawandel verschlimmerten Naturkatastrophen, die scheinbar zwischen 1980 und 2012 2.5 Millionen Personen „gekostet“ haben, sprich 3‘8000 Milliarden Dollar (berechnet den Preis eines menschlichen Wesens).
4) Das Wunder der Technik
Die Komplettierung der Ökonomie mit der Ökologie, die Kompensierung der Mangel ersterer mit letzterer, dafür reicht es, den Planeten mit einer Produktionsmaschine zu vergleichen und ihn wie einen Motoren mit Überdrehzahl zu reparieren. Es mangelt nicht an technologischen „Tricks“.
Durch Spiegel im Weltraum erhoffen sich Geoingenieure eine Regulierung der Menge an Sonnenwärme, welche die Erde erreicht. Andere glauben, dass sie durch Wasserkatalyse Wasserstoff produzieren könnten, durch Brutreaktoren mehr Energie fabrizieren, als sie konsumieren, oder durch Biotreibstoff, jedoch nicht mehr von Randen oder Palmöl, sondern von Algen. Man experimentiert auch mit der Vergrabung und der Lagerung von CO2 in den Tiefen der Erde, eine einfache Art, das Problem zu begraben.
Der Ökomodernismus (der auch Postökologismus genannt wird), das ist z.B. das Breakthrough Institute (das „Institut des Durchbruches“, gegründet 2007), Förderer einer sicheren und günstigen Atomenergie und einer industriellen Landwirtschaft, die einzige Lösung, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Die Ökologie hat ihre pronukleare Randgruppe, sie argumentiert, es handle sich um eine „saubere“ Energie: Bewaffnet mit Zahlen behaupten ihre Anhänger, dass die Atomkraftwerke, sogar wenn man Tschernobyl berücksichtigt, letztendlich für weniger Tote und Kranke verantwortlich sind als die Kohle.
Diese von milliardenschweren Chefs bezahlten forschenden Zauberlehrlinge machen Lust darauf, den Aufruf der Surrealisten 1959 „die Labore zu leeren“ wieder aufzugreifen. Nur ein Teil ihrer Vorschläge wird das Licht der Welt erblicken, aber ein Teil davon wird verwirklicht werden, sie werden die Wissenschaftsreligion und den Glauben an die technische Allmacht nähren, sie sind umso beeindruckender, als dass ihre „Heldentaten“ über das Verständnis der Normalsterblichen hinausgehen. Vor einigen Jahrtausenden hatten Zehntausende Fellachen, die jedes Jahr eingezogen wurden, um die Pyramiden zu bauen, ein gewisses Verständnis der Bauvorgänge. Für den modernen Menschen ist die „elektronische Platine“ seines Kühlschrankes ein unzugängliches Mysterium.
5) Energie, das magische Wort
Anstelle der Energiekrise suggeriert „Energiewende“ eine Situation, die man dabei ist, in den Griff zu bekommen. Jede Woche kündigt man uns eine neue Technik an, die den Ausstoss von Treibhausgasen ein bisschen reduziert. Weil es an Erdöl (das heute immer noch einen Drittel der weltweiten Energieproduktion garantiert, vor der Kohle) bald mangeln oder es teurer werden wird, bewegen wir uns nun in Richtung Sonnenenergie, Windkraft oder anderer „erneuerbarer“ Energien.
Zuerst einmal schliesst diese „Energiewende“ nicht endgültig mit der Atomkraft ab, sie bleibt unbedeutend in gewissen Ländern (USA), in anderen ist sie zurückgegangen (Deutschland), doch sie bleibt vorherrschend in Frankreich und entwickelt sich in China. Zudem ist es falsch, zu behaupten, dass die Menschheit, nachdem sie vom Holz zur Kohle, dann von der Kohle zum Erdöl und der Atomkraft übergegangen war, heutzutage graduell auf Brennstoffen zugunsten grüner Energie verzichten würde. Die Energiequellen summieren und komplettieren sich eher, als dass die einen die anderen ersetzen würden. Betreffend der Elektrizität kam 2018 64% der weltweiten Produktion von fossilen Brennstoffen, 10% von der Atomkraft und 26% von erneuerbaren Energien.
Die nun mit allen Tugenden geschmückten erneuerbaren Energien nehmen proportional ständig zu, aber in viel zu ungenügendem Ausmass, um uns schon geschehene und vorhersehbare ökologische Schäden zu ersparen. Der Durst nach Energie ist dermassen gross, dass man fossile Brennstoffe benutzen muss, um die nur zeitweise funktionierenden erneuerbaren Energien (25% bis 45% der Zeit für die Sonnenenergie und die Windkraft) zu komplettieren. Schlimmer noch, die „Energieeinsparungen“ (Amazon engagiert sich, bis 2040 die „Kohlenstoffneutralität“ zu erreichen) nähren einen „Wachstum“, der verschlimmert, was sie lösen sollten: industrielle Hypetrophie (die Agroindustrie eingeschlossen), beschleunigte Urbanisierung, gimmickhafter Lebensstil und unaufhörliche Mobilität. Man legt immer die Vorteile und Nachteile von Massnahmen auf die Waage, die unfähig sind, das Klimadrama substanziell zu lösen, nur selten hinterfragt man das Bedürfnis nach Energie.
Die Elektrizität ist durch ihre Fluidität eines Gesellschaftssystems bemerkenswert adäquat, das von der optimalen Produktion und der maximalen Wertzirkulation beherrscht wird, und die Produktion von Elektrizität hat sich zwischen 1973 und 2016 mehr als verdreifacht (der Energiekonsum in all seinen verschiedenen Formen hat sich im gleichen Zeitraum verdoppelt). Ausserdem ist es jene Energieform, welche am besten zu einem immer mehr verbreiteten Lebensstil passt, in reichen wie in armen Ländern und Bevölkerungen, denn man kann sie lagern und in kleinen Mengen transportieren: Heutzutage ist es in Nairobi genau so schwierig wie in Vilnius ohne Batterien und Akkus zu leben.
Es ist nutzlos, das Potenzial der erneuerbaren Energien der technischen Absurdität der kapitalistischen Entscheidungen entgegenzustellen, denn die kapitalistische Produktionsweise strebt nicht nach der thermodynamisch (und noch weniger menschlich) effizientesten Technik, sondern der rentabelsten. Wenn ein Unternehmen ein Erdbeerjoghurt 9‘000 km, d.h. dreizehnmal die Distanz zwischen dem Ort der Produktion und des Konsums, transportiert, dann weil es ein Interesse daran hat. Und wenn die produktivistische Landwirtschaft sieben Kalorien investiert, um eine einzige zu erhalten, dann ist das, weil diese Verschwendung für das Agrobusiness keine ist, sondern die beste Profitquelle, die es finden konnte. Die Rentabilitätskriterien sind nicht die gleichen für den Energiefachmann und den Chef – aber letzterer befiehlt.
Die Elektrizität ist übrigens keine Energiequelle sondern eine Energieform und man braucht schon viel davon, um sie zu produzieren. Obwohl der Anteil erneuerbarer Energie stetig ansteigt (noch bescheiden: er beträgt ungefähr einen Viertel) und die elektrischen Geräte immer weniger Energie verbrauchen, nimmt die Nutzung von Elektrizität mit etlichen Geräten stark zu. „Die Elektrizität wird der Energieträger des 21. Jahrhunderts sein“, verkündet Total. Die Bildschirme, aber auch die Thermometer, Alarme, Kameras, Rollläden, Fernbedienungen, diverse Automatismen, „verbundene Häuser“, ohne zu vergessen, dass Batterien und Akkus geladen werden – mit Elektrizität (auf eine Milliarde Afrikaner besitzt die Hälfte ein Handy, obwohl 700 Millionen keinen Stromanschluss zu Hause haben). Die Energieeffizienz führt zu einem steigenden Konsum: „Die elektrische Zukunft“, die man uns verspricht, wird wenig Einfluss auf den Ausstoss von Kohlenstoffen haben.
6) Masslosigkeit und halbe Sachen
In den Projekten zur Ausweitung von Kohlekraftwerken der „neuen Generation“, die wenig verschmutzen, Solarmodulen, Windkraftwerken und Elektroautos wird ein Wort selten erwähnt: Industrie, denn es würde zu stark daran erinnern, dass all das eine schon steigende industrielle Produktion voraussetzt (und entwickelt). Man benötigt Energie, um Metalle zu extrahieren und sie mit Lastwagen oder Zügen zu transportieren. Die „Kohlenstoffneutralität“ ist eine Utopie in einer Welt, die rastlos Stahl, Zement und Plastik zum Bau von Fabriken, Gebäuden, Strassen, Häfen und Flughäfen produziert und die dort zirkulierenden Geräte fabriziert. Da es zum Erhalt der Energie Energie braucht, muss produziert werden, um die Schäden der Produktion einzuholen. Zur industriellen Verschmutzung kommt die Industrie der Entgiftung hinzu und die Vervielfachung von Abfällen führt zur Tätigkeit, die sie „verwertet“.
Was das Recycling betrifft, das übrigens viel weniger verbreitet ist, als gemeinhin behauptet, ist es mit der Tatsache konfrontiert, dass, je mehr die Fabrikationssysteme, die Transportmittel, die Gegenstände oder Dienstleistungen mit technologischem Inhalt bereichert werden (ein zeitgenössisches Auto enthält mehrere Dutzende elektronische Gehäuse), desto schwieriger wird die „zirkuläre Wirtschaft“, d.h. das Recycling. Viele für die neuen Technologien genutzte Metalle sind nur zu einem kleine Prozentsatz wiederverwertbar.
Als Kompensation für diese denaturierte Welt renaturiert man sie, indem man natürliche CO2-Speicher erschafft: Wiederbewaldung, Wiedererschaffung von Grasland, biologischer Anbau, Wiederansiedlung von Hecken und, in der Stadt, Begrünung von Dächern, Parkplätzen und Trottoirs, der hauptsächliche Effekt davon ist die Erheiterung der Stadtbewohner.
Die Sektoren der aufsteigenden Kraft des green business agieren manchmal als Rivalen der Interessen des Minen- und Erdölsektors, manchmal in Symbiose mit ihnen: Total investiert immer mehr in erneuerbare Energien. Schottland bezieht fast 80% seines Stromkonsums vom Wind und den Gezeiten, man hofft, dass sie bis 2030 50% seines gesamten Energiekonsums abdecken. Andere Länder wie Dänemark entwickeln sich ähnlich. Das sind viele besondere und unumstrittene Fälle, die dazu berufen sind, sich zu entwickeln, doch damit sie die Gesamtheit oder sogar die Mehrheit der Welt erobern, wäre es noch notwendig, dass die für die „Begrünung“ notwendigen immensen Transformationen der industriellen Infrastrukturen schlichtweg möglich sind, d.h. rentabel. Zirkuläre Wirtschaft, „Reparabilität“, Recycling, regenerative Landwirtschaft, verkürzte Lieferkette, nachhaltiges und soziales Finanzwesen – das ganze Arsenal der „gesellschaftlichen (oder sozialen) Verantwortung der Unternehmung“ (CSR) wird, wie es eine Beratungsfirma für CSR gesteht, nur dann eingesetzt, wenn es zu einer Win-win-Situation führt, im Klartext: zu genügenden Gewinnen für die Aktionäre. Lassen wir dem neuen ökologischen Bürgermeister von Lyon das letzte Wort: „Die Unternehmenswelt interessiert sich heutzutage für die Ökologie, weil sie erkannt hat, dass sie die Zukunft ist.“
* * *
Wie es Bordiga 1954 antizipierte, assimiliert die Ökologie alles mit Kapital, sie ist der Meinung, dass ein „Naturkapital“ existiert und „behandelt den Planeten als Kapital“ oder als „Grundeigentum der Aktiengesellschaft“, welche die menschliche Gattung sei. Es ist ein begrifflicher Widerspruch: Ein Kapital existiert, um verwertet zu werden, und es wird nur insofern gewahrt, als dass es seine Verwertung nicht behindert. Der Bourgeois praktiziert die Ökologie wie der Autofahrer, der zugleich auf die Bremse und das Gaspedal tritt.
G. D., Dezember 2020
Literaturverzeichnis
Europäische Kommission, „EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS)“.
WWF, „Meeresschutz - ohne Meer kein Leben“.
Weltweite Energieproduktion 2012.
„La production mondiale d’électricité : une empreinte-matière en transition“, 2018.
Andreas Malm, Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Verso, 2016.
Fossile Ressourcen und was nicht extrahiert werden sollte:
Michael Jakob & Jérôme Hilaire, „Unburnable Fossil-Fuel Reserves“, Nature, 2015.
ADEME, „La Face cachée du numérique“, 2018.
ADEME, „Le Revers de mon look“.
Beispiel eines reformistischen Ökologismus: „Scénario négaWatt 2017-2050. Dossier de synthèse“.
Heather Rogers, Green Gone Wrong. Dispatches from the Front Lines of Eco-Capitalism. How Our Economy is Undermining the Environmental Revolution, Verso, 2013. Was Heather Rogers sehr gut aufzeigt, sie betont die Abwesenheit einer solchen Revolution.
Über die zeitgenössische kapitalistische Krise: De la crise à la communisation, Entremonde, 2017, Kapitel 4.
Und die letzten Kapital von Bruno Astarian und Robert Ferro, Ménage à trois, Asymétrie, 2019.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 04: Scheitern der politischen Ökologie
Obwohl sie vieles trennt, haben regierungstreue Umweltschützer, Umweltschützer der kleinen Schritte, Ökosozialisten und radikale Umweltschützer eines gemeinsam. Unabhängig davon, ob sie auf einen Ministerposten schielen, eine Genossenschaft für solidarische Landwirtschaft gründen, das Programm einer künftigen „wahren Linken“ schreiben oder versuchen, aus der Ökologie einen Hebel der gesellschaftlichen Umwälzung zu machen, stellen sie alle die „ökologische Frage“ ins Zentrum der gegenwärtigen Welt, als ob sie uns heute dazu verpflichten würde, das Wesen des Kapitalismus und seiner notwendigen und möglichen Transformation neu zu definieren. Sie halten sich auch alle für realistisch und brüsten sich damit, zu agieren, ohne sich mit schönen Worten abspeisen zu lassen.
Doch was ist die Bilanz ihrer Aktionen seit nun zwei Jahrzehnten?
1) Der Rad fahrende Liberalismus
In den USA der 1960er Jahre entwickelte sich ein bunt gemischter Ökologismus, begünstigt durch den Bestseller von Rachel Carson Der stumme Frühling (1962), der die Vögel tötenden Pestizide denunzierte. 1970 fand der erste „Tag der Erde“ statt, eher eine offizielle Feier denn eine aktivistische Aktion. Im Namen des Konsumentenschutzes wird Ralph Nader danach viermal Kandidat für die Präsidentschaft sein.
In Frankreich insistierte René Dumont, der erste Umweltschützer, der 1974 für die Präsidentschaft kandidierte, auf der Unfähigkeit des kapitalistischen Systems, den Hunger, die Überproduktion und den Überverbrauch von Energie zu eliminieren. Gemäss ihm verläuft die gesellschaftliche Trennung nicht zwischen Bourgeois und Proletariern, sondern zwischen Konsumenten der reichen Länder und benachteiligten Massen in der Dritten Welt, welche die wahrhaften modernen Proletarier verkörpern.
Im 21. Jahrhundert gilt Dumont als Pionier einer guten Sache: Die Ökologie ist eine Selbstverständlichkeit und kann die einander fernsten Positionen versöhnen. In ihrem Namen kann man sowohl sehr radikale als auch sehr versöhnliche Reden halten, von links bis rechts (sogar bis zur „reaktionären“ extremen Rechten, die sich als antibürgerlich proklamiert und für eine Rückkehr zu einer authentischen Natur wirbt, die keine Ware ist) und vom revolutionärsten bis zum gemässigsten Anarchismus (Bookchin).
Für die öffentliche Meinung, die Medien und die politische Klasse wird die Ökologie zu einem unerlässlichen Bestandteil von jedem Diskurs über die Welt (aber nicht einhellig: Trump war nicht der einzige Klimaskeptiker an der Spitze eines Staates). Und für einen – sehr minoritären – Teil, der sich als gesellschaftskritisch betrachtet, komplettiert sie einen oberflächlichen Antikapitalismus: Man ist für die Ökologie genau wie man „gegen die Finanz“ ist.
Die prominentesten ökologischen Organisationen hatten sich um die Liberalen Bill Clinton und Al Gore geschart, Vertreter eines Welthandels, der für den vermehrten Kohlenstoffausstoss verantwortlich ist. Die WTO, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) und das globalisierende Kapital bekamen die Unterstützung von „Big Green“, d.h. jene der ökologischen NGOs, finanziert von grossen Unternehmen und die wie sie funktionieren: Geldanlagen, Marketing, Rekrutierung von Managern mit hohen Löhnen… Die deutschen Grünen zeigen ihrerseits den französischen Umweltschützern den Weg: Jenseits des Rheins begleitet der „Ökoreformismus“ die sozialliberale Verwaltung des Kapitalismus mithilfe von Bündnissen die von Mitte-Rechts bis Mitte-Links reichen. Heizung durch Geothermie, Rückgriff auf wenig verschmutzende Verfahren und Materialien, Zunahme erneuerbarer Energien und Ausbau von Radwegen bringen die grünen Abgeordneten dazu, die Einschränkung der Arbeitslosengelder, der Renten und der sozialen Ausgaben zu akzeptieren…
2) Lob der Mässigung
Da die Konfrontation mit dem Globalen unmöglich scheint, sollen wir lokal handeln, verkünden uns die Anhänger des small is possible wieder und wieder. Für sie hat die menschliche Gattung übertrieben, seien wir nun also weise, in kleinem Massstab, oder gar individuell: Da jeder von uns als verantwortlich für die Klimaerwärmung betrachtet wird, erlaubt ein Online-Rechner, permanent die von unseren alltäglichen Taten und Handgriffen ausgelösten Treibhausgase zu messen.
Als ob die Produktion vom Konsum abhinge! Die Zahl von 130 Millionen monatlich verkaufter Smartphones ist beeindruckend. Aber in Frankreich waren die Fahrräder zwanzig Jahre vor 1900 von 50‘000 auf eine Million angestiegen und während den „Dreissig glorreichen Jahren“ die Autos von zehn auf dreissig Millionen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts lösen sich Gegenstände einander ab, deren Kauf weder durch Zwang noch durch Werbung durchgesetzt wird: Ihr Gebrauch antwortet auf ein durch den von der kapitalistischen Entwicklung der Epoche gebrachten Lebensstil kreiertes und durch die momentanen Produktionsbedingungen möglich gemachtes Bedürfnis. Auto und Bildschirm erlauben nicht nur Freiheit und Geschwindigkeit, sie sind auch Mittel der Individualisierung und der Sozialisation. Die Verknappung von (schon) knappen Böden wird eine Auswirkung auf die gegenwärtige Omnipräsenz der Touchscreens haben, doch es ist illusorisch, zu glauben, dass die Umweltkrise zu einer Bewusstwerdung führen wird, die danach die Verhaltensweisen transformieren wird, als ob ein Schock reichen würde, um einen Kranken zu heilen.
Die sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre begünstigten die Theoretisierung einer Überwindung des Kapitalismus in konfusen und vielfältigen Formen, aber allgemein mit einer Gemeinsamkeit: Die Machtergreifung der Arbeiter wurde als die Lösung betrachtet. Die Erschöpfung der Kämpfe dieser Epoche machte ein solches Ziel kaum konzipierbar für die folgenden Generationen, da es an geistigen Werkzeugen mangelte, um eine Welt ohne Lohnarbeit und Geld zu denken. Allenfalls bleibt die Abschaffung des Staates in den Köpfen der Radikalsten. Für viele Autoren und Aktivisten beschränkt sich das Ende des Kapitalismus allerdings darauf, die Herrschaft der Oligarchie und der Banken zu beenden, damit wir mit mehr Demokratie und Gleichheit in allen Bereichen besser leben können. (Man könnte sagen, das sei nicht schlimm, da die Proletarier, welche die Revolution machen werden, wenig Bücher lesen und keine Aktivisten sind, aber das gesellschaftliche Vorstellungsvermögen spielt in dieser Geschichte trotz allem eine Rolle.) Da man also den Kapitalismus nicht zerstören kann, versucht man, daraus herauszukommen, indem man – sehr partiell – wieder an das vorindustrielle Zeitalter anschliessen will, indem man das weglässt, was am Hypermaschinismus offensichtlich schlecht ist (die verschmutzende Raffinerie), gleichzeitig jedoch das behält, was an ihm gut sei (die Informatik). Dank dem 3D-Drucker, auf Wiedersehen Metallarbeiter. Mit dem Internet braucht man kein Auto mehr. Gegen das Monopol, das Kleineigentum. Gegen die Agroindustrie, der lokale Produzent. Handgemachtes Bier statt Skøll. Die gemeinschaftliche Werkstatt gegen die gigafactory (local is beautiful).
Wie kann man ernsthaft daran glauben, dass die Zukunft der Welt von einer Vervielfachung individueller Handlungen abhängt? Als ob es von jedem von uns als Konsumenten davon abhinge, für die „glückliche Nüchternheit“ zu optieren, während unsere Entscheidungen nach und nicht vor den Produktionen intervenieren, die im Wesentlichen von den Kapitalbewegungen abhängen. So schätzt man – ein Beispiel unter anderen –, dass 70% der zwischen 1988 und 2015 ausgestossenen Treibhausgase von nur 100 Multinationalen verursacht wurden.
Die Utopie ist nicht mehr, was sie einmal war. Die Produktions- und Lebensgenossenschaften der 1840er Jahre waren Ausdruck der Hoffnung, die entstehende Industriegesellschaft von innen zu besiegen, jene der Belle Époque waren häufig mit einer kräftigen und antibürgerlichen Arbeiterbewegung verbunden. Fast zwei Jahrhunderte später koexistieren die sehr rentablen Bio-Verteilketten und die bescheidenen Genossenschaften für solidarische Landwirtschaft fast friedlich mit dem Riesen Carrefour: Es geht nur noch darum, so wenig schlecht wie möglich da zu leben, wo es der Kapitalismus erlaubt.
3) Ökosozialismus
Ein breites Spektrum an Denkern und Gruppen möchte, dass die Ökologie zu einer Wiederzusammensetzung der politischen Linken beiträgt, d.h. die Parteien und Gewerkschaften verjüngt, manchmal sogar in einem marxistischen Duktus, im Sinne einer Analyse der modernen Gesellschaft als kapitalistisch und in Klassen aufgetrennt, obwohl es mehr um Gegensatz denn um Widerspruch geht.
Diese Strömung wirft den Anhängern der Regierungsökologie sowie den Vertretern der „kleinen Schritte“ ihren Mangel an Kohärenz vor: Da, so sagt sie, die Kapitalisten und die Reichen verantwortlich für die Klimakrise sind, sind es sie, die man angreifen muss. „Das Problem ist das Kapital“: Doch für die Ökosozialisten ist „Kapital“ Synonym für grosse industrielle und finanzielle Lobbys. Die Rettung des Planeten impliziert also, dass sie ausgeschaltet werden, damit Schluss ist mit den verschmutzenden Unternehmen, der fossilen Extraktion (oder sie zumindest beträchtlich reduziert wird), der Expansion des Agrobusiness und der Einkaufszentren, damit die öffentlichen Dienste (besonders die Transporte) wiederbelebt werden, damit eine zugleich „gerechte“ als auch ökologische Steuerpolitik eingeführt wird, womöglich durch die Durchsetzung einer ökologischen Rationierung, zum Beispiel durch die Begrenzung der Flugreisen, all das zur „Rückgabe des Wortes und der Entscheidungsmacht ans Volk“.
Im Gegensatz zur „alten“ Arbeiterbewegung setzt der Ökosozialismus auf eine Koordination der Kräfte, die über die organisierte Arbeit hinausgeht: In den sogenannt reichen Ländern die Frauen, die sexuellen und „rassischen“ Minderheiten, eine „für das Klima“ mobilisierbare Jugend und in jenen Ländern, welche man die Dritte Welt nannte, die indigenen Völker, die Bauernorganisationen… Die Vereinigung aller unterdrückten Kategorien würde ein Kräfteverhältnis schaffen, das fähig wäre, eine politische Macht aufzugleisen, die, da von nun an reell und nicht mehr formell demokratisch, einen öffentlichen Sektor im Dienste der Arbeiter und seiner Nutzer befördern würde.
Das alte sozialistische Programm versprach, „die Anarchie der Produktion“ mithilfe eines vergesellschafteten und geplanten Kapitalismus zu überwinden. Im 21. Jahrhundert würde diese bezähmte und wieder in den Dienst aller gestellte Wirtschaft nicht nur von oben gesteuert (vom Staat und dem Parlament), sondern auch durch das Zusammentreffen der Volksvertreter und der Bürgerkollektive (als Adjektiv ersetzt citoyen häufig das heute etwas antiquierte populaire). Gegenüber der allzu jakobinischen Parole der „Nationalisierungen“ bevorzugt man die „Vergesellschaftung“ der Energie und des Kredits.
Die Sozialdemokratie ist tot oder sehr krank, weil sie der Verteidigung der Arbeit (der „kleinen Leute“, der Armen, jener von „unten“) entsagt und das gesamte offen bürgerliche Programm oder einen (grossen) Teil davon akzeptiert hat. Der Widerspruch des Ökosozialismus ist es, dieses Scheitern überwinden zu wollen (das, vom Standpunkt der herrschenden Klasse und ihrer Sprecher aus betrachtet, ein Erfolg ist), indem er tiefe ökologische Transformationen verspricht, die noch weniger zugänglich als die zwar gemässigten Reformen sind, welche die verschiedenen „Linken der Linken“ seit 20 oder 30 Jahren nicht durchsetzen können.
4) Aktivistische Ökologie
Eine ökologische Randgruppe ist der Ansicht, dass es bereits zu spät für eine „nachhaltige Entwicklung“ ist. In Anbetracht der Passivität der Regierenden und der Obsoleszenz der Parteien müsste man sich von der Basis aus organisieren, indem man sich auf die Vision einer verpackten Maschine mit überhitztem Motor stützt, die immer weniger leistungsfähig, somit immer verhängnisvoller ist, aber (zum Glück) auch immer verwundbarer, also empfänglich für einen Zusammenbruch unter dem Druck der extensiv definierten Massen. Daher kommt ein bewusst verteidigter Pragmatismus, Priorität hat die Aktion, am besten auf der Strasse, begleitet von symbolischen, manchmal spektakulären oder gar illegalen Taten.
Die Vertreter der „Märsche für das Klima“ halten diese Umzüge für notwendig, sie wissen, dass sie nicht genügen und sehen sie allen voran als Mittel zur Mobilisierung und zur Verstärkung des Drucks. Individuelle und kollektive Praktiken sollen miteinander kombiniert werden, um gesellschaftlich ins Gewicht zu fallen: Die „Waffe der Brieftasche“ (Kauf von Bioprodukten) schliesst weder den Rückgriff auf die Urnen (grün wählen), noch die Erschaffung von „Basen“ (ZAD) aus, wo ein gesellschaftlich und politisch alternatives Leben skizziert werde, das heute ein schlichtes Mittel zur Verteidigung ist, aber morgen zu einem Werkzeug für eine antikapitalistische Offensive werden wird.
Was diese Praktiken festigt, ist die Illusion einer Mobilisierungs- und Vereinigungskraft der – eingetretenen oder bevorstehenden – Katastrophe. Im Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutung, zu einem Krieg oder gar Weltkrieg oder einer schlimmen Wirtschaftskrise, ist heute die Gesamtheit der menschlichen Gattung betroffen und nicht eine oder mehrere ihrer Bestandteile (Arbeiter, Bauern, Kolonialisierte, indigene Völker, Frauen…). Die Menschheit wäre also fast schon verpflichtet, zum „Subjekt“ ihrer Geschichte zu werden. Die ökologische Krise habe diesen Vorteil, endlich alle beherrschten Kategorien in einer „Bewegung der Bewegungen“ zu vereinen (wie in „der Versammlung der Versammlungen“ scheint die Wiederholung des Wortes sowohl Kraft als auch Diversität zu garantieren). Es bliebe also nichts anderes übrig, als dafür zu sorgen, dass sich die Gesamtheit der Bewohner des Planeten dessen bewusst werden.
In Wirklichkeit gibt es eine Vielzahl an direkten Aktionen gegen die extraktivistischen fossilen Projekte, ohne dass man von einer Konvergenz sprechen könnte, und die von Naomi Klein geschätzte Blockadia löst keine internationale Koordination aus. Die Widerstände knüpfen solidarische Verbindungen, erschaffen manchmal provisorisch autonome Zonen, von welchen in der Regel eine auf die andere folgt: Wenn man einmal den Sieg errungen oder sich die Niederlage eingestanden hat, ziehen die Zadisten um in eine andere ZAD und, falls notwendig, erschaffen sie dort eine, wo ein grosses nutzloses Projekt mit viel Beton angekündigt wird. Leider ist die Zusammenbringung spezifischer Kämpfe gleichbedeutend mit der Erschaffung eines Konkurrenzverhältnisses zwischen Aktivisten jeder dieser Kämpfe an einem gleichen Ort, der daraufhin zum idealen Spielfeld für interne Rivalitäten wird, manchmal geht sogar das ursprüngliche Ziel der betreffenden ZAD vergessen.
Die Vermehrung der ZAD wird genauso wenig das „Globale“ blockieren wie die damals von der organisierten Arbeit (Gesellschaften zur gegenseitigen Unterstützung, Vereine, Genossenschaften, Gewerkschaften und Parteien) erreichte Stellung den Kapitalismus zerstörte. So sehr die ZAD häufig ein Ort positiver Konfrontationen sind, so sehr verbreitet der Zadismus die Illusion, dass die ökologischen Fragen ein optimales Terrain für eine „Kampffront“ und ein Kräftemessen mit dem Staat bieten, solange man die richtigen Kampfmethoden wählt. Man vergisst, dass keine Dringlichkeit in sich selbst eine vereinigende und Veränderung tragende Kraft hat.
* * *
Die politische Ökologie behauptet, sie würde Ressourcen, besonders Energie, für ein System sparen, das zur Überproduktion und zum Überkonsum verurteilt ist. Doch, obwohl es besser ist, fossile Energiequellen mit erneuerbaren zu ersetzen, haben letztere ihre Grenzen, besonders ihr zeitweiliges Funktionieren. Mit dem der kapitalistischen Welt inhärenten Durst nach Energie muss gebrochen werden, doch dazu ist die Ökologie als Wissenschaft und Politik unfähig. Der Beweis dafür ist ihre Akzeptanz für die Digitalisierung von allem, die eine Omnipräsenz der Elektrizität und die Gesamtheit ihrer Konsequenzen voraussetzt. Die politische Ökologie liefert ein und demselben System nur andere Lösungen.
Schlussendlich ist die Bilanz, für Leute, die sich mit ihrem Realismus brüsten (und uns gerne unseren „Utopismus“ vorwerfen), mager. Die reformistischen Umweltschützer reformieren kaum etwas und die Radikalen erhalten kaum mehr als die Gemässigten. Die Klimasituation wird schlimmer: Der Verbleib unter einer Schwelle von 1.5° oder 2° C der Erwärmung würde bis 2030 und 2050 eine Transformation der Produktionsweise und unserer Lebensweise verlangen, die heute nicht absehbar ist. Im Wettlauf zwischen Verbesserung und Verschlimmerung hat der Planet bis jetzt weitgehend verloren. Nie sprach man jedoch so viel von Ökologie. Politisch betrachtet ist das Scheitern offenkundig.
G. D., Januar 2021
Literaturverzeichnis
Rachel Carson, Der stumme Frühling (1962), C. H. Beck, 1976.
René Dumont, L’Utopie ou la Mort, Seuil, 1973.
Serge Latouche, Vers une société d’abondance frugale, Mille et une nuits, 2011.
Serge Latouche zeigt gut die Grenzen der „nachhaltigen Entwicklung“ auf, d.h. eines weniger verschmutzenden Kapitalismus, damit er länger fortbestehen kann. Aber da Kapitalismus für ihn Synonym für Grenzenlosigkeit ist, geht es darum, uns Grenzen zu geben. Er bezieht sich besonders auf Beispiele von Tauschsystemen in Afrika und verteidigt einen Warenhandel, der sich nicht an der „Omnipräsenz des Marktes“ orientieren würde. Auf dem Weg der Mässigung trifft er Castoriadis, den er lobend zitiert: „Als Werteinheit und Tauschmittel ist das Geld eine grosse Erfindung, eine grosse Kreation der Menschheit“ und es solle nun genügen, „die Wirtschaft wieder im Sozialen zu verankern“. Es ist eine Lobrede auf eine kleine Warenproduktion, einen Präkapitalismus, der unfähig wäre, den Kapitalismus zu gebären, da er unter all unserer Kontrolle verbleiben würde. Die Entwicklung des Handels in Athen und die mittelalterlichen Messen und Jahrmärkte haben allerdings zur Börse Amsterdams und zu Wall Street geführt. Serge Latouche glaubt, ein Problem durch ähnliche Mittel lösen zu können, wie jene, welche es verursacht haben.
Ökosozialismus:
In seinen etlichen Varianten präsentiert der Ökosozialismus zwar eine „Klassenanalyse“ des ökologischen Problems, seine Lösung ist allerdings transversal und interklassistisch, ein breites Bündnis, das Arbeiter, grüne Aktivisten, Frauen, Völker des Südens, Menschenrechtsaktivisten und Unterdrückte aller Kategorien miteinander mischt (nur die „oligarchischen“ 1% sind davon ausgeschlossen). Es ist das ewige Programm einer unmöglichen graduellen Revolution, ausser dass sie heute „ökodemokratisch“ wäre.
Daniel Tanuro, L’Impossible Capitalisme vert, La Découverte , 2012.
Michel Husson, Six milliards sur la planète : sommes-nous trop ?, Textuel, 2000.
Ein Beispiel einer Konvergenz zwischen universitärem Marxismus und ehemaligen intellektuellen Kadern der KPF: Jean-Marie Harribey, „Marxisme écologique ou écologie politique marxienne“, Dictionnaire Marx contemporain, PUF, „Actuel Marx confrontation“, 2001.
Homepage Climate & Capitalism („Ecosocialism or barbarism: there is no third way“).
Schule des „Risses des Stoffwechsels“ (von der wir in der Episode 07 erneut sprechen werden):
Paul Burkett, Marx‘s Vision of Sustainable Human Development, 2005.
John Bellamy Foster, Brett Clark und Richard York, The Ecological Rift. Capitalism’s War on the Earth, Monthly Review Press, 2010.
Zu den politischen Vorschlägen Fosters.
Naomi Klein, Die Entscheidung: Kapitalismus vs. Klima, Frankfurt a.M., S. Fischer, 2015 [2014]. Der Titel – Kapitalismus vs. Klima – greift direkt einen Kapitalismus an, dessen Ursachen in den Kapiteln 2 bis 5 beschrieben werden, aber nicht seine tiefe Logik. Obwohl scharfsinnig bezüglich der Grenzen der politischen Ökologie und des Greenwashing vertraut Naomi Klein hingegen auf eine Änderung der Haltung der Regierungen und des Big Business, falls die Massen ein bisschen überall Druck machen: Blockadia wird stärker sein als das „Globalia“ der Multinationalen. Für sie genau wie für die Ökosozialisten wäre der Kapitalismus nicht mehr kapitalistisch, wenn er von uns allen, dem Volk, kontrolliert wäre.
Linksaussen fühlt sich mittlerweile jede Partei oder Gruppe verpflichtet, ihrer Zeitung oder ihrem Blog eine ökologische Seite beizufügen. Ein Beispiel von Opportunismus unter hunderten: „La IVe Internationale victime du réchauffement climatique“ in Le Prolétaire, September-Oktober 2019.
Was Le Prolétaire erklärt, ist kein Standpunkt, der sich auf diese trotzkistische Gruppe beschränkt. Ein grosser Teil der äusseren Linken tendiert dazu, den Widerspruch Bourgeoisie/Proletariat als sekundär gegenüber jenem zwischen dem übermässigen kapitalistischen Wachstum und den natürlichen Grenzen zu betrachten, ein Gegensatz, der den Vorteil hat, dass er fast alle betrifft: Sowohl die Proletarier als auch die Frauen, die sexuellen Minderheiten, die Unterdrückten aufgrund ihrer „Rasse“, die Jungen und auf allgemeine Art und Weise die Völker jener Länder, welche früher als Dritte Welt bezeichnet wurden, sie alle sind auf die eine oder andere Weise Opfer des Klimawandels und somit geeignet dafür, für Aktionen „für das Klima“ mobilisiert zu werden. Doch, wie es die Situationisten schrieben, „[m]an sollte aber noch die Mittel zum eigenen Opportunismus besitzen“ [16].
Die „Tiefenökologie“ ist ein Fall für sich. Die Anhänger der deep ecology werfen der klassischen und der antikapitalistischen Ökologie vor, die Gesamtheit des Lebens nur vom Standpunkt der menschlichen Gattung aus zu betrachten und sich nur insofern für ökologische Ungleichgewichte (der Verlust der Biodiversität z.B.) zu interessieren, als dass sie den Menschen schaden. Für diese Strömung darf die Gesamtheit der lebenden Welt nicht als „Ressource“ behandelt werden: Sie hat einen Wert, der unabhängig von ihrer Nützlichkeit für die menschlichen Wesen ist.
Das steht im Verhältnis zur Idee, dass die Umweltkrise uns dazu verpflichtet, den „Gesellschaftsvertrag“ der modernen Demokratie mit einem „Naturvertrag“ (Michel Serres) zu ersetzen oder ihn damit zu komplettieren, ein „Parlament der Dinge“ (Bruno Latour) einzusetzen und den nichtmenschlichen Wesen Rechte einzuräumen, was auch ein Thema des Antispeziesmus ist, aber all das würde zu weit gehen.
Damit dieser Text nicht noch schwerfälliger wird, werden wir hier auch Gruppen wie Deep Green Resistance oder Extinction Rebellion nicht behandeln, sowohl ihre Funktionsweise als auch ihre Theorien würden eine Kritik verdienen.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 05: Vom Anthropozän zum Kapitalozän
Die Idee des Anthropozäns sollte die Ankunft einer Epoche ausdrücken, während welcher die menschlichen Tätigkeiten nunmehr alles Leben auf der Erde modifizieren. Doch die unbestreitbare Verantwortung des kapitalistischen Systems in der ökologischen Krise zeigte, wie offensichtlich vereinfachend, wenn nicht schlichtweg falsch dieser Begriff war. Daher kommt der Aufstieg einer kritischen Neuheit, des Kapitalozäns, das, obwohl es sich explizit auf einen „Kapitalismus“ bezieht, letztendlich unterschlägt, was er eigentlich ist, und nur meist fade politische Perspektiven vorschlägt, die jedenfalls weit von einer sozialen und ökologischen Revolution entfernt sind.
* * *
In den 1920er Jahren behauptet Wladimir Wernadski, dem wir schon in der ersten Episode begegnet sind, dass „mit dem Menschen gewiss eine neue geologische Kraft auf der Erdoberfläche erschienen ist“. So wie er sie konzipiert, ist die Biosphäre, die Einheit der Interaktionen zwischen lebenden Organismen und ihrer Umwelt, positiv, denn Wernadski glaubt, dass das Menschengeschlecht das Leben auf der Erde verbessert, vorausgesetzt, dass es sich selbst dazu in den Stand versetzt.
Die Entstehung einer solchen Sichtweise im bolschewistischen Russland ist kein Zufall. Schon davor gab es zahlreiche Projekte eines humanisierten Planeten, von Francis Bacon, der im 17. Jahrhundert die Wissenschaft und das Experimentieren als notwendige Werkzeuge für den menschlichen Geist zur Aneignung der Natur betrachtete, bis zu den französischen Enzyklopädisten und vielen anderen danach. Aber die Oktoberrevolution bietet einer Gruppe von Anführern den Eindruck, über ein gesamtes Land und seine Bevölkerung zu herrschen und fähig zu sein, sowohl den Menschen als auch die Natur umzugestalten.
Die Hypothese und das Wort werden damals im Westen kaum oder überhaupt nicht beachtet, man bevorzugt den Begriff Holozän, vom griechischen holos (gänzlich) und kainos (neu), das vor ungefähr zwölf Jahrtausenden nach der letzten grossen Eiszeit beginnt und die gesamte Epoche der menschlichen Zivilisation umfasst, seit der Erfindung der Landwirtschaft und der Entstehung der ersten Siedlungen, d.h. seit der „neolithischen Revolution“. Einer, der diesen Begriff eifrig gefördert hat, war Gordon Childe (1882-1957), der stark vom Marxismus inspiriert war und insbesondere 1936 Man Makes Himself geschrieben hat, ein Titel, der aussagekräftiger ist als jener der französischen Übersetzung, L‘Invention de la civilisation (1963).
1) Ein kritisches Konzept
Die Idee des Anthropozäns verweist ihrerseits auf einen Bruch und unterscheidet eine neue Periode: Jene, während welcher die Menschen den Planeten zutiefst und in einer qualitativ neuen Art und Weise transformieren. Aber bis zu welchem Punkt? Und mit welchem Ausgangspunkt? Das Ende des Mittelalters und die grossen Entdeckungen oder aber die industrielle Revolution? Wir werden die Probleme der beiden Ansätze im nächsten Kapitel sehen. Es geht auf jeden Fall darum, die durch die Erde und die Menschheit konstituierte Gesamtheit als globales System mit Schlingen- und Schwellenwirkung und somit einer möglichen Gefahr zu denken. Die Gesellschaft stellt sich nunmehr die Frage, wie sie ihre eigenen Missetaten „reparieren“ kann.
Vom Anthropozän zu sprechen, bedeutet, die Geschichte in zwei Teile zu unterteilen: Im ersten wirkte das Menschengeschlecht auf seine Umwelt ein, ohne ihre grundlegenden Gleichgewichte zu erschüttern; im zweiten, in welchem wir leben, hat dieses Handeln die Natur derart transformiert, dass die Lebensbedingungen auf der Erde – vielleicht auf unumkehrbare Art und Weise – bedroht sind.
Das russische Denken nach 1917 sah ein „gutes“ Anthropozän. Heute sei es das Gegenteil.
Der Nobelpreisträger Paul Josef Crutzen nannte 2002 Anthropozän „die gegenwärtige geologische Epoche, die von den Menschen beherrscht und auf das Holozän gefolgt ist, d.h. die gemässigte Periode der letzten zehn oder zwölf Jahrtausende. Wir schlagen für den Beginn des Anthropozäns die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts vor: Während dieser Periode zeigen die Daten, die aus glazialen Eisbohrkernen gewonnen wurden, den Beginn einer Zunahme der atmosphärischen Konzentrationen mehrerer ‚Treibhausgase‘, insbesondere CO2 und CH4. Ein derartiges Anfangsdatum fällt auch zusammen mit der Einführung der Watt’schen Dampfmaschine im Jahre 1784.“
Wie wir es in der letzten Episode gesehen haben, ist das Interesse der Theoretiker und Forscher gegen Mitte des 20. Jahrhunderts auf das Missverhältnis zwischen der Rohstoffverknappung und dem demographischen Wachstum (oder gar der demographischen „Explosion“) und kaum auf das CO2 und die Erwärmung gerichtet. Der Gegenstand der Beunruhigung ändert sich in den 1980er Jahren (1988, Kreation des IPCC): Die Klimaveränderung wirft Fragen auf und stellt eine globale Bedrohung dar, die den gesamten Planeten betrifft, Grossmächte genau wie „Schwellen-“ oder „periphere“ Länder, die Regierenden müssen sich also darum kümmern, oder zumindest darüber sprechen. Ohne zu vergessen, führen die Anhänger des Anthropozäns ins Feld, dass gewisse Länder mehr Verantwortung tragen als andere. Die Idee knüpft an eine aufstrebende grüne Bewegung an, welche die ökologische Krise auf die Hyperindustrialisierung zurückführt, und den Ökosozialismus, der darin eine Auswirkung des Kapitalismus sieht.
Das Wort kommt wie gerufen.
2) Periodisierung
Was wir „Wissenschaft“ nennen, ist nichts anderes, als jenes Wissen, welches durch eine Epoche nach den Kriterien derselben als wissenschaftlich anerkannt wird. Die wissenschaftliche Welt funktioniert mit Kommissionen, Unterkommissionen, kollegialer Bewertung, sie ist gefangen zwischen korporatistischen (Karrieren, die gefördert, Veröffentlichungen, die garantiert werden müssen, und Finanzierung, die erhalten und erneuert werden muss) und politischen Interessen: Die Klimaskeptiker werfen dem IPCC übrigens vor, ein Produkt der Übereinkunft zwischen Regierenden zu sein und deshalb nach Konsens zu streben. Wenn „wir“ heute „offiziell in der Periode des Holozäns, im Quartär leben, so ist das einer Reihe historischer Unfälle und Abstimmungsprozeduren einer kleinen Anzahl Geologen geschuldet“ (Simon Lewis, Mark Maslin).
In weniger als 20 Jahren ist das Anthropozän zu einem Konzept (und einer Formel) geworden, das für eine Welt notwendig geworden ist, welche es nicht lassen kann, sich bezüglich der Beschleunigung eines industriellen Wachstums, das die für jede Gesellschaft – auch eine kapitalistische – notwendigen natürlichen Gleichgewichte bedroht, zu hinterfragen.
Das Anthropozän wird allerdings auch in einem anthropozentrischen Sinne von den Ökomodernisten theoretisiert, für sie müssen wir jetzt in ein „gutes Anthropozän“ eintreten: Dank seiner Technologie wird der Mensch der beste Garant für das planetarische Gleichgewicht sein. Die Wissenschaftsgläubigkeit tankt in der Ökologie neue Energie.
Die Periodisierung wirft weit mehr als nur lexikalische Fragen auf. Je nachdem, ob man einem Holozän, der sich über ungefähr 13‘000 Jahre erstreckt, oder einem bloss einige Jahrhunderte altem Anthropozän anhängt, weichen die Erklärungen für zeitgenössische Phänomene voneinander ab. Aber im Rahmen des Anthropozäns muss auch der Beginn der historischen Beschleunigung aufgrund des Kapitalismus datiert werden. Und man muss wissen, wann die kapitalistische Produktionsweise beginnt. Mit der Industriellen Revolution, wie es Paul Crutzen vertritt? Oder im 15. und 16. Jahrhundert mit den grossen Entdeckungen und dem Beginn der Kolonialisierung Amerikas durch mehrere europäische Länder? Das Konzept „Kapital“ kann viele Bedeutungen annehmen, wir werden in der nächsten Episode darauf zurückkommen.
3) „Inszänierung“
Das Anthropozän bedeutet die Ära des Menschengeschlechts, doch was man als Triumph für den Menschen hätte betrachten können, erweist sich als seine schlimmste Niederlage. Nach Galileo, Darwin und Freud erleidet die Menschheit eine „neue narzisstische Kränkung“. Ein sehr nützliches Konzept, um die Mässigung der Regierenden als einzige Lösung zu präsentieren und jedem zu empfehlen, sich selbst einzuschränken (ihn dabei jedoch zum Konsum zu ermuntern).
Was die Nüchternheit betrifft, ist sie nicht sprachlich. Es wimmelt von Neologismen. Gross- oder kleingeschrieben: Misanthropozän, Soziozän, Phagozän (geplante Obsoleszenz), Plantationozän, Anglozän, Thanatozän, Plastozän, Ökonozän, Technozän, Thermozän, Phronozän, Homogenozän, Polemozän, Imperialismozän, Nekrozän und auf Englisch manthropocene (zur Betonung der patriarchalen und sexistischen Dimension) und growthocene (Wachstumszwang), ohne das Chthuluzän von Donna Haraway zu vergessen (das nicht mit dem schrecklichen Cthulhu von Lovecraft verwechselt werden sollte)…
Die Ungewissheit darüber, was „das Anthropozän“ umfasst, führt dazu, dass die Definitionen sich vervielfachen, eine zieht die andere nach sich, als ob eine entschlüpfende Wirklichkeit mit einem Wort festgehalten werden sollte. Statt dass man die Ursachen der Unangemessenheit des Konzepts versteht, vervielfacht man es, jede Variante theoretisiert einen besonderen Aspekt so, als ob er die Totalität kennzeichnen würde.
Es ist der Widerspruch eines Begriffes, der, obwohl er den Menschen infrage stellt, ihn im Zentrum platziert und so ein vereinigtes Menschengeschlecht gegenüber der Natur zusammenbringt, eine Doppeldeutigkeit, die auf das Auftauchen der Idee in Russland vor einem Jahrhundert zurückgeht: Die zuerst leninistische dann stalinistische UdSSR gab vor, auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft zu sein, in Richtung einer mit sich selbst und der Natur versöhnten Menschheit.
4) Kritik des Konzepts
Was das Konzept des Anthropozäns ausdrückt, ist die Tatsache, dass die menschlichen Aktivitäten zu einer „geophysischen Kraft“ mit der Fähigkeit geworden sind, den Planeten bis zu einem Punkt der Belastung der Biosphäre zu transformieren.
Aber welche menschlichen Aktivitäten?
Welche Rolle die Anhänger des Anthropozäns dem Kapitalismus auch immer einräumen mögen, ihre Wortwahl Anthropo-zän setzt die Geschichte mit einer Evolution gleich, welche die Menschheit von der „Eroberung des Feuers“ vor 500‘000 Jahren zum heutigen Wärmekraftwerk geführt hat.
Wenn auch die menschlichen Gesellschaften nicht auf die kapitalistische Produktionsweise gewartet haben, um die Ausbeutung, die Klassen, den Staat, die Zügellosigkeit usw. zu erschaffen und zu erdulden, so gibt der Kapitalismus doch all dem eine neue Qualität und es ist kein Zufall, dass er die Industrie, den Extraktivismus und den Produktivismus entwickelt. Er ist viel mehr und etwas anderes als eine (extreme oder letzte) Etappe in einem technologischen Fortschritt, der mit der Landwirtschaft begonnen hat (oder noch früher mit der Domestizierung des Feuers, um nicht zu sagen mit dem Schneiden des Feuersteins) und danach mit der industriellen Eskalation verschlimmert worden ist. Das Anthropozän macht somit aus der Menschheit einen historischen Agenten jenseits der Klassenteilungen und analysiert die Erde als kybernetische Apparatur, die lange fähig war sich selbst zu regulieren – bis sie durch die menschliche Aktivität dereguliert worden ist.
Diese Positionen werden namentlich 2013 im Buch L‘Événement Anthropocène von Christophe Bonneuil und Jean-Baptiste Fressoz ausgeführt. Drei Jahre später zur Neuauflage des Buches legen die Autoren Wert darauf, „das Manuskript in der Tiefe“ zu „überarbeiten“ und sie fügen ein Kapitel über das „Kapitalozän“ hinzu, das „die sehr ungleiche Aneignung der ökologischen Gebrauchswerte des Planeten und die gemeinsame Dynamik des Kapitalismus und der Transformationen des Erdsystems seit einem Vierteljahrtausend“ untersucht.
Diese Autoren haben ihre Analyse also modifiziert. Sie erklären, dass das Konzept des Anthropozäns das Menschengeschlecht zu Unrecht als homogenes historisches Subjekt betrachtet. In Wirklichkeit ist der industrielle Aufbruch von einem Handelskapitalismus, der die Menschen und Ressourcen der Welt seit dem 16. Jahrhundert zugunsten der grossen europäischen Mächte ausgebeutet hat, vorbereitet worden. Deshalb verlangt das Verständnis darüber, wie der menschliche Einfluss auf die Biosphäre letztlich das Überleben der Menschheit bedroht, die Ursache und den prinzipiellen Motor davon anzuerkennen: den Kapitalismus.
Nach dem Anthropozän ist nun sein Rivale, der Kapitalozän, dran, in Mode zu sein, er regt Bücher und Kommentare von immer mehr, stark oder entfernt marxistisch inspirierten Radikalen an. Wir werden uns auf zwei Autoren konzentrieren, die sehr verschieden, aber repräsentativ sind.
Zuerst Andreas Malm, der 2009 das Wort Kapitalozän zum ersten Mal benutzt haben soll.
5) Andreas Malm oder das fossile Zeitalter
Da der Kapitalismus nun im Vordergrund steht, welche Rolle spielt er im Begriff des Kapitalozäns?
Fossiles Kapital
Aufgrund der Tatsache, dass sich der Kapitalismus mithilfe der Gewinnung fossiler Materialien aufgebaut hat und immer noch darauf basiert, setzt Andreas Malm die beiden gleich. Gewiss, sagt er, jede fossile Ökonomie ist nicht kapitalistisch: Die UdSSR nutzte Kohle, Öl und Gas, war aber, gemäss ihm, nicht kapitalistisch. Jeglicher Kapitalismus ist hingegen fossil und mit dem Verschwinden der UdSSR „ist die fossile Ökonomie inhaltsgleich mit der kapitalistischen Produktionsweise, aber jetzt weltweit“ [17].
Andreas Malm ist nicht der erste, der das kapitalistische Wesen der UdSSR verkennt und einige werden darin eine zweitrangige Schwäche in einem obsoleten Streit sehen, da das Land seit fast 30 Jahren nicht mehr existiert. Wir vertreten eher die Meinung, dass eine Unfähigkeit, zu verstehen, dass das Kapital und die Lohnarbeit 1980 sowohl in Charkiw als auch in Pittsburgh – natürlich auf verschiedene Art und Weise – herrschten, ein schlechtes Vorzeichen ist, um den Kapitalismus im Allgemeinen zu behandeln.
In L‘Anthropocène contre l‘histoire definiert Malm die fossile Ökonomie „schlichtweg als eine autonome Wachstumsökonomie, die auf einem zunehmenden Konsum fossiler Brennstoffe gründet und somit ein anhaltendes Wachstum von Treibhausgasemissionen generiert“.
Die Erschaffung des Konzepts des fossilen Kapitals bei Malm ist widersprüchlich. Er zeigt auf überzeugende Art und Weise, inwiefern das Zurückgreifen auf Kohle, dann auf Erdöl Klassenverhältnissen geschuldet ist, d.h. wie diese fossilen Brennstoffe in den Dienst eines Gesellschaftssystems gestellt worden sind, doch er definiert dieses System nicht ausgehend von seiner Ursache (dem Klassenverhältnis), sondern seiner Auswirkung (der Wahl der Rohstoffe). Seine „Theorie des fossilen Kapitals“ interpretiert alles ausgehend von diesem Aspekt um: „fossile Ökonomie“, „fossile Zusammensetzung“ (des Kapitals), „globalisiertes fossiles Kapital“, „fossiler Konsum“, „fossiles Subjekt“… Diese fossile Ökonomie, ein neues Stadium des Kapitalismus, definiere ihn neu: So wie es früher das Kupfer-, Bronze, Eisenzeitalter gegeben habe, würden wir nun das fossile Zeitalter erleben.
Wird das angekündigte Ende des Erdöls in einigen Jahrzehnten eine Theorie des „nuklearen Kapitals“ hervorbringen?
Es scheint uns richtiger, die kapitalistische Produktionsweise durch das Verhältnis zwischen der Arbeit und dem Kapital, die Unternehmung, die Tendenz, aus allem eine Ware zu machen, und die Akkumulation zu definieren, nicht durch ihre Abhängigkeit von einer Energiequelle oder -form, wie wichtig sie auch sein mögen.
„Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll“
Die Wahl dieses Titels – jener eines Artikels Lenins, der im September 1917 Geschichte schrieb – ergibt sich aus der Tatsache, dass Malm seine Inspiration in einem vom ökologischen Lichte neu erhellten Leninismus findet.
Die im letzten Kapital seines beim Verlag La Fabrique herausgegebenen Buches dargelegte „revolutionäre Strategie“ hat zum Ziel, „Das Kommunistische Manifest“ durch die Anfügung einer Liste von zehn dringend umzusetzenden Massnahmen „zu aktualisieren“, namentlich: die Schliessung fossiler Kraftwerke, eine komplett durch erneuerbare Energien gesicherte Energieproduktion, Begrenzung (durch gerechte Rationierung) der mit dem Flugzeug zurückgelegten Strecken, Entwicklung kollektiver Transporte, Priorisierung lokaler Lebensmittel, Aussetzen der Entwaldung, Isolierungsplan für Gebäude, Zerschlagung der Fleischindustrie, für die Energiewende bestimmte öffentliche Investitionen.
Das wäre nur ein Anfang, gibt Andreas Malm zu, der aber, sagt er, wahrscheinlich mit einer Revolution gleichzusetzen wäre, sowohl hinsichtlich der gesellschaftlichen Verhältnisse als auch der Produktivkräfte.
Doch in der Logik Andreas Malms ist es der letzte Punkt (die öffentlichen Investitionen), der die anderen antreibt. Aber wer hätte diese öffentliche Macht inne? Von welchem Staat spricht er? Wenn Malm, wie Naomi Klein und viele andere, die Frage der politischen Macht unterschlagen kann, dann, weil er in der ökologischen Frage jene gemeinsame Sache sieht, die es endlich erlauben würde, das Gefälle der Bedingungen und der Konflikte zu überwinden: „Der gegenwärtige Kapitalismus ist dermassen gesättigt von fossiler Energie“, dass heute jede in einer sozialen Bewegung engagierte Gruppe letztendlich objektiv die Klimaerwärmung bekämpft. Es würde also reichen, „das breitestmögliche Bündnis“ zu realisieren, von den Brasilianern, die kostenlosen öffentlichen Verkehr verlangen, über die europäischen Arbeiter des Automobilsektors, die schon bald, so vermutet er, dazu veranlasst sein werden, ihre Werke in Fabriken für Windräder und Busse zu verwandeln, bis zum Ogoni-Volk, das Shell in Nigeria die Stirn bietet – denn für ihn „sind alle Kämpfe Kämpfe gegen den fossilen Kapitalismus: Die Subjekte müssen nur das Bewusstsein dafür erlangen.“ Damit würde sich die politische Frage von alleine lösen, die Schwere der ökologischen Situation genügt, um eine mit einer sozialen Revolution zusammenfallende ökologische Revolution durchzusetzen, beide davon global.
Um das zu belegen, zitiert Malm eine Reihe von Erfolgen auf allen Kontinenten, vom Rückzug der Öltanker in der Arktis über die Annullierung von Kohleprojekten bis zu Kampagnen für den Rückzug von Investitionen. Das sind freilich Siege, aber sie sind nicht minder partiell als jene des alten Reformismus der Arbeiter und sie mildern die Auswirkungen, ohne die Ursachen zu erreichen. Den vom Autoren erwähnten Beispielen könnte man hundert andere entgegensetzen, wo die Revolte gegen die Degradierung der Umwelt und der Lebensbedingungen es nicht schafft, die wahrhaften Verantwortlichen zu erreichen, und es kommt ausserdem häufig vor, dass die ökologischen Schäden dergestalt behandelt werden, dass gewisse gesellschaftliche Schichten zufriedengestellt werden, während die Ausbeutung anderer verschlimmert wird. Wenn Malm schreibt, dass „die globale Klimabewegung die Bewegung der Bewegungen sein muss“, wovon spricht er dann? Die Ökologie ist nicht der Hebel, der die Gesamtheit der Beherrschten gegen ihren gemeinsamen Feind vereinen wird.
Hinsichtlich der Strategie kommt der Bezug auf 1917 ungelegen. Wenn die bolschewistische Partei Erfolg hatte mit ihrer Revolution, indem sie genügend Arbeiter- und Bauernmassen gegen das vereinigt hatte, was tatsächlich eine soziale Katastrophe war, dann, weil das Scheitern der Führungsschicht eine Lücke schaffte, die sie erfolgreich füllen konnte. Ein Jahrhundert später halten die bürgerlichen Klassen trotz ihres Leides überall die Zügel der Macht in der Hand und es sind sie, welche die gegenwärtige ökologische Katastrophe (schlecht, aber gemäss ihrem Interesse) verwalten.
6) Jason Moore und die „cheaps“
Die Ambition der Weltökologie von Jason W. Moore ist alles andere als gering: das Marxsche Konzept des „Risses des Stoffwechsels“ überwinden, die Theorie der Akkumulationskrise und die Analyse der Umweltkrise synthetisieren, kurz, die wahrhaftige ökologische Kritik formulieren.
Die Natur arbeitet
Was Moore allem „grünen“ Denken, dem ökologischen Marxismus und dem Ökosozialismus mit eingeschlossen, vorwirft, ist die Tatsache, dass es sich für „das interessiert, was der Kapitalismus mit der Natur macht“, ohne zu verstehen, „wie die Natur für den Kapitalismus arbeitet“. Was wir gewöhnlich „Arbeit“ nennen, sei nur eine ihrer Manifestierungen, denn für Moore ist sie zugleich „menschlich und tierisch, botanisch und geologisch“. Die Gesamtheit der menschlichen und nichtmenschlichen Natur bildet das, was Moore „Lebensnetz“ nennt, worin der Kapitalismus weniger ein gesellschaftliches System als eine Organisation der Natur in der Biosphäre darstellt und der Proletarier nicht der einzige Wertproduzent: „Die Flüsse, die Wasserfälle und die Wälder arbeiten auch“ und schaffen Wert, wenn das Kapital ihre Energie ausbeutet. Moore macht aus der Energie einen Produktionsfaktor, was sie freilich ist, doch er setzt sie mit der Arbeit gleich. Der Kapitalismus beruhe auf der Existenz unbezahlter Arbeit, die gleichermassen von einer gnadenlos ausgebeuteten Natur und der Lohnarbeit geliefert werde. Aber wenn man sagt, dass ein Fluss „arbeitet“, bedeutet das nur, dass eine zum Damm gebrachte Wassermasse eine Turbine antreibt: Eine auf ein Objekt angewandte Kraft transformiert es. Während er glaubt, die Natur in die Analyse des Kapitals einzubringen, benutzt Moore bloss die Sprache der Physik.
Aneignung
„Die Arbeit der Afrikaner und jene der Böden und Wälder ist angeeignet worden.“ (Interview mit Kamil Ahsan)„Die angeeignete Natur ist eine Produktivkraft.“ (Kapitalismus im Lebensnetz)
Für Moore hängt die kapitalistische Akkumulation von einer immer grösseren Masse „unbezahlter Arbeit/Energie“ ab (die Verbindung der beiden Wörter dient als Konzept), die von der menschlichen und nichtmenschlichen Natur geliefert wird und die unbezahlte, grossmehrheitlich von Frauen geleistete Hausarbeit enthält und die Energie der Wälder, Böden, Ozeane und Mineralien. Das lässt sich in Zahlen ausdrücken, versichert Moore: Erstere trage 70 bis 80% zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt bei, letztere 70 bis 250%. Ja: 250% – ein unglaublicher Prozentsatz, ausser für Moore, der überzeugt davon ist, dass die „ökosystemischen Dienste“ so viele aufeinanderfolgende „Akkumulationswellen“ genährt haben, dass ihr Beitrag über die Fassungskraft hinausgeht. In Anbetracht eines solch unerhörten Phänomens führt der Durst nach Erklärungen dazu, dass man jeden Unsinn akzeptiert.
Gemäss Moore ist die produktive Arbeit des Lohnarbeiters oder der Lohnarbeiterin nur eine sekundäre Ursache der Produktion und Reproduktion des Kapitals. Die Aneignung ist nicht mehr nur eine der offensichtlich notwendigen Bedingungen der Ausbeutung, sie wird selbst zu einer Form davon. Das Kapital bemächtigt sich eines indonesischen Territoriums, eliminiert dort den Wald, um dort Ölpalmen zu pflanzen, und gemäss Moore genügt schon diese Aneignung selbst, um Wert zu schaffen, schon bevor die Arbeit des in der Palmölplantage angestellten Proletariers das tut.
In einem Interview mit dem Online-Magazin Période definiert der Autor den Kapitalismus als System „der Aneignung der Frauen, der Natur und der Kolonien“. Doch diese drei historischen Phänomene findet man auch in anderen Herrschaftssystemen. Obwohl sie tatsächlich eine der Existenzbedingungen der kapitalistischen Produktionsweise sind, ist es die Ausbeutung der Arbeit, die sie definiert und ihre Besonderheit ausmacht.
Was Moore betrifft, wird hingegen die Aneignung als zentral für den Kapitalismus theoretisiert. Wie es Jean Parker angemerkt hat, macht Moore in der Dialektik der Produktion (der Ausbeutung) und der Plünderung (der Aneignung) die Plünderung zum wichtigsten Element: Herrschaft und Enteignung stehen bei ihm im Zentrum.
Die politische Konsequenz davon ist (wir werden weiter unten erneut davon sprechen), dass, wenn die Welt auf einem „mutwilligen und permanenten Diebstahl“ zuungunsten uns aller beruht, wenn der Gegensatz Bourgeois/Proletarier sekundär oder gar vernachlässigbar wird, die Lösung eine Rückgabe, eine kollektive Wiederaneignung impliziert, die das Werk der Gesamtheit der Enteigneten und Beherrschten unabhängig von ihrer Klassenzughörigkeit ist.
Theorie der „cheaps“
Moore erklärte 2014 den Kapitalismus durch die Tatsache, dass Arbeit (menschliche muss präzisiert werden, denn für Moore arbeitet nicht nur das menschliche Wesen), Nahrung, Energie und Rohstoffe durch die Aneignung der unbezahlten Arbeit der Frauen, der Natur und der Kolonien billig (cheap) geworden sind. Drei Jahre später erzählt er in einem mit dem kritischen Ökonomen Raj Patel geschriebenen und im folgenden Jahr ins Französische übersetzten Buch „die Geschichte der Welt als Geschichte sieben billiger Dinge“ und fasst den Gang des Kapitalismus durch die Schaffung dieser „cheaps“ und ihrer Preisvariationen zusammen.
Es ist wahr, dass die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise besonders auf den geringen Kosten für Lebensmittel beruht, die Abschaffung der Getreidegesetze in England im 19. Jahrhundert durch die Niederlage der Grundeigentümer gegen die Bourgeois, die weniger teures Getreide zur Ernährung ihrer Arbeit importieren wollten, ist nur eine Episode davon.
Doch für Moore, der seinem Konzept der sowohl von der Natur als auch vom Proletarier gelieferten Arbeit/Energie treu bleibt, ist die Arbeit nur einer der „cheaps“: Gemäss ihm ist die Arbeit zwar wesentlich für das Kapital, aber nicht, weil sie die Schaffung von Wert erlaubt, sondern nur weil sie nicht viel kostet, sie verwerte das Kapital übrigens weniger als zum Beispiel ein unentgeltlich angeeigneter Boden oder Fluss.
Darüber hinaus erkläre die cheapisation nicht nur die fünf Jahrhunderte der globalen Expansion des Kapitalismus, sondern führe auch, wie wir sehen, zu seiner neuzeitlichen Krise.
Dead Man Walking
Für Jason Moore ist es ziemlich einfach, die „ökologische Krise“ in den Zusammenhang der „allgemeinen Krise“ des neuzeitlichen „Kapitalismus“ zu stellen: Die kapitalistische Produktionsweise hat bis anhin regelmässig ihre Grenzen überwunden, jetzt könne sie es nicht mehr, da sie nun mit der Umwelt mit dem Unüberwindbaren zusammenstösst.
Früher konnten die – unter Druck geratenen – Bourgeois Lohnerhöhungen zugestehen und die Arbeiter zumindest provisorisch beschwichtigen. Heutzutage geht die Beschleunigung der globalen Kapitalisierung der Natur über die Möglichkeiten der Aneignung der „cheaps“ hinaus, die Produktionskosten für Energie und Landwirtschaft steigen kontinuierlich an, die ökologischen Forderungen – da sie Punkte betreffen, wo die Unternehmen keinen Spielraum haben – können nicht mehr befriedigt werden, der Kapitalismus ist unfähig geworden, jene zu „kaufen, welche ihn herausfordern“, das also, was Moore „ökologischen Mehrwert nennt, geht zur Neige. Die menschliche Emanzipation hat nun eine gewichtige Verbündete: die Natur.
Der Kapitalismus stiess regelmässig mit einer Grenze zusammen und überwand sie: Dieses Mal sei das unmöglich. Man kann fast alles mit den Proletariern tun und sie alles tun lassen, den Roboter Ebo, „den idealen Spielgefährten für ihre Katze“, kaufen, sowie mit weniger als einem Dollar pro Tag leben, die menschliche Gesellschaft und die Ausbeutung sind grenzenlos, doch die Natur hingegen kann nicht nach Belieben gestaltet werden und indem er sie ausschöpft, hat der Kapitalismus aus ihr sein entscheidendes Hindernis gemacht. Man kann der Überakkumulation und den Schuldenbergen abhelfen, man bleibt machtlos gegenüber der „ökologischen Knappheit“. Die Natur ist eine Kraft, die nicht bezwungen oder integriert werden kann: Es besteht nicht das geringste Risiko für einen reformistischen Syndikalismus oder eine Wahl Trumps oder Macrons seitens des CO2 oder des kolumbianischen Waldes, die Ökosysteme machen keine Politik, sie werden nicht besiegt werden können wie die vom Krieg hinweggeraffte Arbeiterbewegung 1914.
„Wir erleben den Zusammenbruch des Kapitalismus.“ (Mediapart 2015)
„Natürlich geht er weiter. Doch er ist eine wandelnde Leiche.“ (The Capitalocene and the Planetary Justice)
Wenn das gesamte Leben revoltiert
Da für Moore die kapitalistische Produktionsweise aus ihrem letzten Loch pfeift, setzt er es, nachdem er ein Panorama der allgemeinen Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Proletarier und – was für ihn wichtiger ist – die Natur erstellt hat, als Gewissheit, dass diese Verschlimmerung Bewegungen auslösen wird und schon auslöst, welche die Ursachen des Übels und nicht nur die Auswirkungen angreifen. Der Kapitalismus (aber ist es noch Kapitalismus oder schon eine Kombination von „Kapitalismus in der Natur“ und „Natur im Kapitalismus“?) sei in seiner letzten Krise, wovon für Moore weniger eine verallgemeinerte Verarmung als ihr vereinigender Effekt wichtig ist.
Tatsächlich reihten die Opfer des Kapitalismus, da heterogen, zuvor ihre Kämpfe aneinander, eine „gemeinsame Wurzel“ macht nun ihre Vereinigung möglich: der Klimanotstand.
Die Bewegung für die „planetarische Gerechtigkeit“, für die Gleichheit der „Rassen“, Konsumentenverbände, Occupy, Lohnkämpfe, Forderungen der Hausarbeiter, indigenen Völker, #MeToo, Migranten – was sie verbinden wird, ist „die Weltökologie“. Da er das Objekt der kapitalistischen Ausbeutung auf den gesamten Planeten ausgedehnt hat, verfügt Moore über das breitest vorstellbare historische Subjekt: „Auf einem gewissen Niveau revoltiert das gesamte Leben gegen die Verbindung [nexus] des modernen Werts, der modernen Monokultur, des Bauernhofes mit der Fabrik.“ Das Konzept des „Lebensnetzes“ dient dazu, alles, „soziale Momente“ und „ökologische Momente“, „in einer Periode, wo die menschliche und die aussermenschliche Natur immer mehr durchmischt sind“, zusammenzutragen (Interview mit Mediapart).
Die vergangene und gegenwärtige Erfahrung zeigt eher, dass Arbeiter, Bauern, Frauen, people of colour und ökologische Opfer des Kapitalismus, Kategorien, die selten übereinstimmende Interessen haben, sich begegnen, ohne sich zusammenzuschliessen.
Doch für Moore sind die Revoltierenden so zahlreich, dass der Übergang in eine andere Gesellschaft aus einfachen Massnahmen bestehen und für alle zugänglich sein wird: „Neue Arten, sich hervorzubringen und sich umeinander zu kümmern praktizieren, eine Praxis, die darin besteht, unsere grundlegendsten Beziehungen neu zu erstellen, neu zu denken und neu zu erleben.“ Es braucht überhaupt keine Konfrontationen, noch weniger Klassenkonfrontationen (wenn das gesamte Leben revoltiert, sind die Bourgeois auch lebendig), und keine Zerstörung des Staates.
Ein sehr kompliziertes konzeptuelles System, um zu derart bescheidenen und naiven Vorschlägen zu kommen.
7) Ein Konzept verschlingt ein anderes
Malm und Moore sind sehr verschieden: Ersterer kommt aus der äusseren Linken Schwedens und bereut es, nicht mehr genügend Zeit für Aktivismus zu haben, letzterer ist gut eingerichtet in der Universität. Doch sie teilen diesen gemeinsamen Punkt: Vom Kapitalozän zu sprechen, erlaubt es ihnen, zu sagen, dass die kapitalistische Produktionsweise in der Welt die Führungsrolle einnimmt und sie in die Katastrophe führt, welche ihrerseits sehr wahrscheinlich zum Ende des Kapitalismus führen wird.
Doch für sie, genau wie für die meisten Theoretiker dieses Konzepts, ist die Tatsache, einen wahrlich wichtigen Aspekt des Kapitalismus ans Licht zu bringen, gleichbedeutend mit dem Gebot, ihn ausgehend von diesem Aspekt (neu) zu definieren. Jede Epoche der kritischen Theorie tendiert dazu, die kapitalistische Produktionsweise ausgehend von dem zu verstehen, was sie in dieser Epoche geworden ist, von ihren sichtbarsten Eigenschaften, aus welchen man also ihren wesentlichen Widerspruch macht, jener, welcher dieses System dynamisiert, ist auch jener, welcher es zerstören könnte. Mitte des 19. Jahrhunderts war es das Elend, die Deklassierung, die Arbeiteraufstände. Ende des 19. Jahrhunderts: Ein Kapitalismus der Kartelle, der Trusts – gegen den sich die in grosse Parteien und Gewerkschaften organisierte Arbeit auflehnt. Anfang des 20. Jahrhunderts: Der Kriege auslösende Imperialismus führe das Proletariat zur Revolution. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, betritt die Klimafrage die Bühne. Jedes Mal wird der Kapitalismus, seine Mechanismen und sein möglicher, wenn nicht unvermeidbarer Sturz neu definiert: Denn jedes Mal wird das hervorgehobene Merkmal sowohl als wesentlich als auch als auf Dauer, kurz- oder mittelfristig, unhaltbar präsentiert. Was die kapitalistische Dynamik ausmache, sei auch und zwingend seine letztendliche Unmöglichkeit.
Die scharfsinnigste ökologische Kritik hat die Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise bei Marx oder bei Autoren entdeckt, die in irgendeiner, teils sehr vagen Weise marxistisch sind (Foster, O‘Connor, Wallerstein, Arrighi, Harvey…). Was vor allem als ein „Erdsystem“ analysiert worden war, ist nun Teil von „technokapitalistischen Weltsystemen“ geworden. Doch die „grosse Beschleunigung“ ist nicht gleichbedeutend mit dem Auftauchen einer Megamaschine, die dem menschlichen Grössenwahn geschuldet ist, oder einer ungezügelten technischen Hyperentwicklung (oder den beiden kombiniert). Sie ergibt sich aus dem Aufstieg eines Systems der Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital und der peripheren Länder durch jene des Zentrums: Ein „Weltsystem“, das auf einer „Weltökologie“ gründet (früher sagte man „Imperialismus“).
Gleichzeitig bleiben die politischen Perspektiven unverändert. Theoretiker und Akademiker, obwohl sie sich als äusserst innovativ präsentieren, haben nur einen einzigen Horizont: Eine immer noch von der Lohnarbeit und der Ware geprägte Gesellschaft mit demokratischen Korrektiven, dank welchen die Lohnarbeit und die Ware nichts mehr mit dem zu tun haben, was sie gegenwärtig sind. Ein Kapitalismus mit wahrhaft menschlichem Antlitz und (neuerdings) in Harmonie mit der Natur.
Dieses den meisten Autoren gemeinsame Programm erneuert jenes – veraltete oder tote – eines Volksstaates, der die „Produktivkräfte“ in die Hand nimmt, um es als Ökosozialismus neu zu beleben: „Ökologie + Demokratie + gemeinschaftliche Produktion“ durch ein gesellschaftliches Leben, das nicht mehr vertikal, sondern horizontal organisiert ist. Die kommunistische Kritik wird nicht einmal widerlegt, nur verschwiegen: Es geht nicht mehr um die Abschaffung der Klassen (in der Genossenschaft gibt es weder Chefs noch Angestellte), die Zerstörung des Staates (der überbordet und dann faktisch in einer seine Funktionen garantierenden Föderation von Kollektiven aufgelöst wird) oder das Verschwinden des Geldes (es wird angeblich reduziert auf ein buchhalterisches Werkzeug). Eine ökologische Planwirtschaft, die durch eine demokratische Verwaltung verwirklicht wird, wie sie in Rojava entworfen werde. Wenn man einen emblematischen Ideologen unserer Zeit nennen müsste, wäre es offensichtlich weder der Bolschewist Lenin noch Pannekoek oder Bordiga, sondern der (sehr) gemässigte Anarchist Murray Bookchin.
Je mehr sich das ökologische Problem einer Welt auferlegt, die unfähig ist, damit umzugehen, desto stärker löst es eine vielseitige, sowohl vage als auch breite Kritik aus, unter anderem in der Universität, die als denkender Kopf für eine sich auf der Suche nach einer Lösung befindliche bürgerliche Gesellschaft fungiert. Moore ist ein Symptom. Nie gab es mehr Nummern von Zeitschriften über Marx, in welchen eine ähnliche Anzahl paramarxistischer Akademiker über den Kapitalismus schreiben, während sie proklamieren, dagegen zu sein (sie sind es, aber im doppelten Sinne des Wortes).
Die Anhänger des Kapitalozäns legen reelle Tatsachen und sogar wichtige Widersprüche dar: Das Problem daran ist, dass das, was nur halb wahr, vollständig falsch ist. Denn ist dieses „Kapitalozän“ noch Kapitalismus?
Das „Kapitalozän“ wird als eine neue Epoche präsentiert, die zutiefst anders sei, da sie auf mehr beruhe, als auf dem Verhältnis Kapital/Lohnarbeit. Natürlich präzisiert man manchmal, dass dieses Verhältnis wesentlich bleibt, doch es sei notwendig, dieser Wesentlichkeit eine andere hinzuzufügen, womit es nicht mehr wirklich wesentlich ist. Die politische Konsequenz daraus ist, dass die zeitgenössische kapitalistische Produktionsweise, da sie anders sei, andere Lösungen erfordere: Wenn das Klassenverhältnis nicht mehr zentral ist, ist es der Kampf Proletarier/Bourgeois auch nicht mehr, die Lösung impliziert also eine Kombination von Bewegungen jenseits der Klassen. Im 21. Jahrhundert ist es, um (auch in den „Mainstreammedien“) kommentiert zu werden, nicht schlecht, vom Kapitalismus zu sprechen und sogar ihn zu kritisieren, unter der Bedingung, ein weiterhin als zu störend empfundenes Proletariat zu vernachlässigen und, in Tat und Wahrheit, nicht die Abschaffung des Kapitalismus in Betracht zu ziehen, sondern seine Humanisierung. Während er scheinbar eine grundlegende Kritik vorbringt, läuft der ökologisierte Marxismus auf einen Neoreformismus hinaus, wo die Veränderung simultan von oben (vom Parlament) und von unten (von Kollektiven, die das alltägliche Leben verändern) kommen soll.
* * *
Die unbestreitbare Verantwortung des kapitalistischen Systems in der ökologischen Krise machte die Grenzen des Begriffes des Anthropozäns offensichtlich. Daher kommt der Aufstieg einer theoretischen Innovation, des Kapitalozäns, das, als „Globalisierung“ seit den 1990er Jahren, alles für alle bedeuten kann.
Kapitalozän… Man sollte meinen, dass diverse kritische Geister das Konzept des „Kapitalismus“ passend für das 19. und einen Teil des 20. Jahrhunderts hielten, aber für ungenügend befanden, um das 21. Jahrhundert zu begreifen. Das Wort ist jedoch nicht so alt. Es kommt übrigens im Kapital (1867) nicht vor: Marx und Engels sprachen vom „kapitalistischen System“ oder von der „kapitalistischen Produktionsweise“. Der Begriff „Kapitalismus“ existierte bereits, doch erst Ende des 19. Jahrhunderts geht er in den gängigen Sprachgebrauch über, um eine Gesellschaft und eine Welt zu beschreiben, die zutiefst vom Kapital und der Konfrontation zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Klasse durchdrungen sind. Das Wort ist also genügend sinnträchtig, um dazu beizutragen, die moderne Geschichte zu verstehen.
Der Erfinder von Neologismen ist immer zufrieden mit seinem Fundstück und von seiner Bedeutung überzeugt.
Was dieses Feuilleton anbetrifft, geht es nun darum, den Kapitalismus zu analysieren.
Doch zuvor kann ein Kapitel über eine andere modische Denkschule, jene des Zusammenbruches, nicht schaden.
G.D., Februar 2021
Literaturverzeichnis
Anthropozän:
Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’Histoire et Nous, Paris, Seuil, 2013. Lange Auszüge aus dem Buch.
Für eine Kritik dieses Buches: Sylvain Di Manno, „La force géologique du capitalisme“ in Contretemps, 2016.
Gordon Childe, Man Makes Himself , 1936. Französische Übersetzung: L’Invention de la civilisation, Gonthier, 1963.
Simon L. Lewis, Mark A. Maslin, The Human Planet: How We Created the Anthropocene, Yale U.P., 2018.
Paul Crutzen, La Géologie de l‘humanité, 2002.
Agnès Sinaï, Quatre avatars de l’Anthropocène, 2012.
Kapitalozän:
Zum Ursprung des Wortes: Donna Haraway, „Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin“ in Environmental Humanities, Bd. 6, Nr. 1, 2015.
Donna Haraway hat zum von James Moore herausgegebenen Band beigetragen, Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, PM Press, 2016. Wir sehen davon ab, uns mit einem Denken auseinanderzusetzen, das metaphorisch zu tentakelartig für uns ist.
Jean-Baptiste Fressoz hat zur letzten Ausgabe des mit Christophe Bonneuil veröffentlichten Buches ein Kapitel hinzugefügt (L’Événement Anthropocène. La Terre, l’Histoire et Nous, Seuil, 2018): „Capitalocène. Une histoire conjointe du système Terre et des systèmes-monde“. Unter diesem Gesichtspunkt eine nützliche Synthese.
Andreas Malm:
L’Anthropocène contre l’histoire. Le Réchauffement climatique à l’ère du capital, La Fabrique, 2017.
„The Anthropocene Myth“, 2015.
Mit Alf Hornborg: The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative, 2014.
„Revolutionary Strategy in a Warming World“, 2018 (eine sehr diskutable Strategie, aber ein dokumentierter Artikel über Syrien, die öko-autoritären Projekte…).
„Le Marxisme écologique“ (synthetische Darstellung seiner Position und kurze Synthese der verschiedenen ökologischen Denkschulen).
„Capital fossile: vers une autre histoire du changement climatique“.
Jason W. Moore:
Kapitalismus im Lebensnetz. Ökologie und die Akkumulation des Kapitals, Matthes & Seitz, 2019.
Mit Raj Patel: Entwertung. Eine Geschichte der Welt in sieben billigen Dingen, Rowohlt, 2018.
Als Herausgeber: Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, PM Press, 2016.
„The End of the Road ? Agricultural Revolutions in the Capitalist World-Ecology, 1450–2010“, 2010.
„The Origins of Cheap Nature: From Use-Value to Abstract Social Nature“, 2014.
„La Nature du capital“, Interview mit Kamil Ahsan, 2015.
„The Capitalocene and the Planetary Justice“, 2017.
Kritik an Moore:
Kamram Nayeri über Kapitalismus im Lebensnetz.
Ian Angus über Entwertung.
Jean Parker, „Ecology and Value Theory. A Review of Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital“, 2017.
Zur Methode:
Moore stellt auf komplizierte Art und Weise einfache Ideen dar, die mit einem die Produktion von wissenschaftlichem Wissen garantierenden kritischen Apparat untermauert werden, auch in einem Buch für die „breite Öffentlichkeit“: Die englische Ausgabe von Entwertung enthält 210 Seiten Text und 90 Seiten Anmerkungen und Referenzen.
Jean Parker zeigt auf, wie Moore mit Wortballungen und Sinngleiten verfährt (eine konstante Praxis des „Modernismus“ der 1960er Jahre, dann des „Postmodernismus“: Man widerlegt Marx nicht, man greift ihn auf und erweitert ihn): „tendenzieller Fall der ökologischen Mehrwertrate“, „ungleichmässige und kombinierte Entwicklung“ [der menschlichen Naturen], „geschlechtsspezifischer Mehrwert“, „Praxis der äusseren Natur“, „Akkumulation durch Aneignung“… Dieser Fluss an Neologismen trägt dazu bei, nicht zu erkennen, wie stark Moore von Marx abweicht, während er glaubt, ihn zu erweitern: Er „präsentiert das, was ihn Wirklichkeit eine grundlegende Ablehnung der Marxschen Vorgehensweise ist, als eine Erweiterung“, sagt Jean Parker.
Moore wird sehr häufig kommentiert: Er hat die Schwere der Ernsthaftigkeit und das Format eines Fabrikanten beliebter Konzepte.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 06: Das Ende der Welt wird nicht stattfinden

„Die Apokalypse, von der man euch erzählt, ist nicht die wahre.“Armand Robin, Poèmes indésirables, 1943-1944
Der Katastrophismus hat Rückenwind, manchmal ist er marxistisch angehaucht, wie wir es im vorhergehenden Kapital gesehen haben: Eine zusammenbrechende Welt reisst uns mit, Handeln ist dringend – oder vielleicht nicht, wenn es schon zu spät ist. Aber um welchen Zusammenbruch handelt es sich?
1) Zusammengebrochen
Der Zusammenbruch ist ein frappierendes Bild: Etwas oder jemand bricht ein. Doch die Verkümmerung oder das Verschwinden von Gesellschaften ist weniger eine Erschütterung oder ein Knall als ein im Allgemeinen von einer langen, häufig mehrere Jahrhunderte andauernden Transformation begleiteter Niedergang und es ist selten, dass der Zerfall nicht gleichbedeutend mit einer Wiederzusammensetzung ist.
„Nur weil die ‚Ressourcen‘ knapp werden und (fast) alle Tätigkeiten radikal relokalisiert sein werden, bedeutet das nicht, dass die aktuellen Organisationsstrukturen unserer Gesellschaften verschwinden, der Produktivismus aufhören wird. Es besteht diesbezüglich ein bedeutender Mangel in der Präsentation des „Höhepunkts“ (der eher eine Hochebene ist) der Produktion fossiler Energien. Es wird stillschweigend angenommen, und manchmal explizit vorgelegt, dass die Verknappung dieser Energien den Zusammenbruch des Kapitalismus auslösen würde. Die Verknappung löst nicht das Ende der Produktionsverhältnisse aus (im Gegenteil). Der Produktivismus wird bis zum Ende, bis zum letzten Tropfen gehen, wenn wir ihn machen lassen. Es [wird] kein mechanisches Ende des Kapitalismus geben […], ‚nur‘ eine Umverteilung der verfügbaren ‚Ressourcen‘ […] und eine gesteigerte Intensität in den Ausbeutungsverhältnissen und der Extraktion der Rohstoffe […] Die Elektrizität wird nicht verschwinden, die Unterbrüche werden sporadisch sein. Das Internet wird nicht von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen, ein Teil der Gesellschaft wird mit mehr oder weniger unbezahlbaren Zugängen davon getrennt werden.“ [18]
Die Atomindustrie wird irgendein armes Land finden, um als Müllhalde für ihre giftigen Abfälle zu dienen. Die 3‘800 Toten in Bhopal 1984 bedeuteten weder das Ende der indischen Chemieindustrie, noch von Union Carbide. Arten können verschwinden und der Aralsee austrocknen, ohne dass die Erde oder das Kapital stillstehen, letzteres hat seine Erneuerungskapazitäten noch nicht ausgeschöpft. Es scheint, wie es vor 40 Jahren Pierre Souyri schrieb, dass „die Existenz des Kapitalismus keine anderen Grenzen als die Durchführung von Revolutionen hat“.
Bis jetzt bleiben die Reformkräfte im Stile Green New Deal eine ausgesprochene Minderheit, aber den herrschenden Klassen mangelt es nicht an Mitteln, um die Auswirkungen der Erwärmung notdürftig zu beheben, mithilfe extrem „barbarischer“ Methoden, falls notwendig. Das 20. Jahrhundert hatte Überraschungen für uns bereit, der Nazismus und der Stalinismus waren nur die auffälligsten davon.
Katastrophe für wen übrigens? Das 1% der Privilegierten wird damit zurechtkommen: „gesicherte“ Wohnenklaven mit ihren eigenen öffentlichen Dienstleistungen (private Polizei inbegriffen), ihren Notgeneratoren, ihren hochwassersicheren Türen… Das Klima ist nicht „der grosse Gleichmacher“. Zudem muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass die Vorhersagen der Kollapsologen nur für die Bewohner der „modernsten“ Regionen einen katastrophalen und apokalyptischen Aspekt haben: Mehr als vier von fünf Menschen müssen schon jetzt häufig eine erzwungene und wenig glückliche „Mässigung“ erdulden… Im Falle eines „Zusammenbruches“ oder eines grossen Klimawandels ist es am wahrscheinlichsten, dass es zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen eines Grossteils der Bevölkerungen ohne Vernichtung des Menschengeschlechts kommt.
2) Das System denken
Die Kollapsologie versteht sich als neue interdisziplinäre Wissenschaft, als Synthese aller anderen, der Human-, Natur- und Lebenswissenschaften – ein authentisches systemisches Denken.
Es ist wahrscheinlich Joseph Tainter, der durch sein systematisch systemisches Vorgehen in seinem bahnbrechenden Buch The Collapse of Complex Societies am besten die Grenzen davon illustriert. Es wurde 1988 veröffentlicht und 2013 dank der Tatsache, dass der Zusammenbruch in Mode war, auf Französisch übersetzt. Aus der Studie der Römer, der Mayas und der Chacoans (der Anasazi-Kultur, im Nordwesten des heutigen New Mexico) zieht er den Schluss, dass eine Gesellschaft das Ungleichgewicht riskiert, wenn einer ihrer grundlegenden Bestandteile sich exzessiv zulasten anderer entwickelt. Doch in Tat und Wahrheit ist für ihn die erste Ursache des Ungleichgewichts eine Produktivitätssenkung, die zu einer ungenügenden Lebensmittelproduktion und somit einem Bruch der gesellschaftlichen Einheit führt, daher Verlust an Dynamik, Zerfall, Invasion.
Im Grunde genommen vergleicht Tainter die Gesellschaft mit einer Maschine, die eine Funktion erfüllt, jedoch zum Zerfall verurteilt sei. Mit einem neuen Vokabular knüpft dieses „komplexe Denken“ an den alten Gegensatz zwischen Rohstoffen und Bedürfnissen, zwischen Produktion und Konsum an, eine vor zwei Jahrhunderten von Ricardo (abnehmende Erträge von Land und Kapital) oder Malthus (die Überbevölkerung übersteigt die Produktion) dargelegte These. In gelehrten Begriffen und mit einer Fülle an Zahlen verkündet uns Tainter, dass die soziopolitische Komplexität es anfangs erlaubt, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, aber dass sie mit der Zeit dazu tendiert, zuzunehmen, immer kostenintensiver und weniger effizient zu werden: Die grossen Systeme wie das Römische Reich verlieren allmählich die zu ihrem Fortbestand notwendige Energie, der Einsturz wird unvermeidlich, auf ihn folgt eine Neugründung oder auch nicht.
Indem er dieses Modell auf die neuzeitliche Welt anwandte, erstellte Tainter 1988 eine pessimistische Diagnose, ohne eine Behandlung in Erwägung zu ziehen, denn dieses Mal, dachte er, kann der negative Ertrag (in jeglicher Hinsicht) nicht wettgemacht werden, umso weniger, weil wir im Unterschied zum antiken Rom in einer globalen Gesellschaft leben, der Zusammenbruch wird also allgemein sein und der Autor setzte kaum Hoffnung in ein „wirtschaftliches Nullwachstum“:
„Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Buch schreibe [1988], kann man kaum wissen, ob die industrielle Welt schon den Punkt erreicht hat, wo der Grenzertrag ihres Investitionsmodells beginnt, abzunehmen. Die jüngste Geschichte zeigt, dass wir abnehmende Erträge betreffend unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und einigen Rohstoffen erreicht haben […] Wir verfügen nicht über die Option, zu einem schwächeren wirtschaftlichen Niveau zurückzukehren, zumindest nicht als rationale Option. Die Konkurrenz zwischen komplexen Regimen führt zu mehr Komplexität und Konsum von Rohstoffen, was immer auch die menschlichen oder ökologischen Kosten dafür sein mögen. Der Zusammenbruch, falls und wenn er wieder eintritt, wird dieses Mal global sein.“
Die Geschichte wird uns hier als Missverhältnis zwischen Bedürfnis und Verfügbarkeit erklärt, die Schaffung von Reichtum wird durch seine eigenen Produktionsbedingungen unmöglich gemacht: Je mehr man investiert, desto weniger Wachstum hat man. Wie damals Rom, aber mit der zerstörerischen Kraft der Industrie und der fossilen Energie. Das systemische Denken Tainters schreibt die bürgerliche Offensichtlichkeit aller Zeiten und aller Regierungen neu: „Man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man hat“, ausser dass „Geld“ mit „natürlichen Rohstoffen“ ersetzt wird (als „guter Familienvater“ verwalten, ironisierte Bordiga 1954).
Können wir uns dem entziehen, was Tainter als etwas präsentiert, das alle Züge eines unvermeidlichen „Gesetzes der Geschichte“ aufweist? Nein, denn der Systemtheoretiker ist häufig ein Pessimist: Einmal mehr war das „System“ stärker, es bleibt uns nichts anderes übrig, als darin so wenig schlecht wie möglich zu leben, indem wir versuchen, uns dem anzupassen, was wir geschaffen haben, aber unfähig sind, wieder aufzuknoten.
3) Gesellschaftsphysik
Das Schlimmste mit den Kollapsologen sind nicht die fehlerhaften Vorhersagen, die ihnen häufig vorgeworfen werden: In mehreren Bereichen stehen die Chancen leider gut, dass sie bestätigt werden. Das Problem liegt im Vorgehen.
Das 19. Jahrhundert hatte eine Gesellschaftsphysik erfunden, welche die menschlichen Organisationen und die gesellschaftlichen Beziehungen studieren und Gesetze der Geschichte aufstellen soll und das mit der gleichen Objektivität wie der Astronom die Gestirne oder der Biologe die Insekten studiert. Besonders Saint-Simon (1760-1825) war ein Verfechter seiner Gesellschaftsphysiologie, die Teil einer allgemeinen Physiologie zum Studium der Funktionsweise von Kollektivitäten war. Aber es ist Auguste Comte, der seine folgendermassen definierte Gesellschaftsphysik Soziologie nennt:
„[D]ie Wissenschaft, deren Studienobjekt die im gleichen Geiste wie die astronomischen, physikalischen, chemischen und physiologischen Phänomene betrachteten gesellschaftlichen Phänomene sind, d.h. unveränderlichen natürlichen Gesetzen unterworfen, deren Entdeckung das besondere Ziel dieser Forschungen ist.“ [19]
Auguste Comte prophezeite eine neue Ära historischen Fortschritts dank der Wissenschaft. Die Kollapsologen des 21. Jahrhunderts, für welche die Katastrophe unmittelbar bevorsteht, suchen ebenfalls die „natürlichen Gesetze“ der „gesellschaftlichen Phänomene“ und ihre Methode ähnelt einer Gesellschaftsphysik.
Die Kollapsologie betrachtet die Welt wie ein Fahrzeug, deren Motor sie demontiert (die Ära der Automatisierung und der Informationstechnologie erfordert den Einsatz von raffinierten mathematischen Modellen, die Auguste Comte nicht kannte). Ihre Analysen haben einen gewissen Verdienst, besonders jenen, dass sie ein grosses Spektrum an Daten zusammenführen, aber ihr grundlegender Mangel ist es, konstant von den Naturwissenschaften in die Sozialwissenschaften abzugleiten und Börsenindizes, Temperaturangaben, Benzinpreise und Extinktionsraten miteinander zu vermischen, als ob die einen die anderen bestimmten.
Doch der Kapitalismus hat sich weder wie eine Maschine gebildet, noch funktioniert er wie eine solche. Man kam nicht zur Kohle, dann zum Erdöl, danach zur Atomenergie gemäss den Kriterien einer besseren Energieleistung. Die Ingenieure stehen im Dienste der Bourgeois. Die auf die Energie angewandten Produktivitätsberechnungen (die „thermodynamische Wand“) erklären kaum die Zu- und Abflüsse von Kapital.
Da er glaubt, sowohl das Menschliche als auch das Natürliche zu berücksichtigen, vermischt der Katastrophismus die beiden und naturalisiert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Man kann nicht ernsthaft vom „Leben“ einer Gesellschaft sprechen, wenn man vergisst, dass es sich um ein Bild handelt und dass eine Gesellschaft nicht wie eine Rose oder eine Katze lebt, wächst und stirbt.
Wenn man so alles vermischt, verwechselt man das Unumkehrbare und das Umkehrbare. Wie es Cravatte bemerkt, gibt es „unumkehrbare Veränderungen – sie kann man nur versuchen, zu begrenzen oder vorzubereiten (wie die Zerstörung der Biodiversität und die Klimaderegulierung)“ und „absolut umkehrbare Veränderungen (wie der Aufstieg der Faschismen, der Transhumanismus oder die Finanzialisierung der Welt)“.
4) Resilienz
Die Kollapsologen sagen einen unvermeidbaren Umbruch voraus und alles, was wir heute tun können, ist, uns auf das vorzubereiten, was uns morgen erwartet: der Tod, die Barbarei oder, unter der Bedingung, es zu wollen und dazu fähig zu sein, ein zwangsläufig vernünftiges und menschengerechtes Leben. Und es fehlt nicht an Ideen und Programmen, um das in der Zwischenzeit umzusetzen: Kleinbetriebe, Kleinhandel, Kleinkonsum, Genossenschaft, lokales Leben, d.h. eine Rückkehr – die erzwungen ist, aber sowohl uns als auch der Natur zugutekommt – zu einem vorindustriellen Zeitalter, jedoch gewiss noch ein bisschen „online“. Keine Autos, aber Computer. Julien Wosnitza, Kollapsologe, 24 Jahre, empfiehlt „Leben ohne Müll und lokales Recycling […], zu versuchen, dem Leben und den Tieren rundherum so wenig wie möglich zu schaden, die Ebene des Lokalen zu erhalten […], eigenes Gemüse anzubauen […], eine Gemeinschaft mit verschiedenen, unabhängigen, zusammenhängenden und resilienten Kompetenzen vorzubereiten. Und, ganz wichtig, allen voran die Liebe nicht zu vergessen.“ [20]
Und vorerst eine Parallelgesellschaft zu organisieren (die aber nicht antagonistisch zur herrschenden Gesellschaft ist), bestehend aus Ökodörfern und „verbindenden Arbeitsgruppen“, Teil „eines immensen lebenden Körpers, wovon wir Teil sind“, der „schon in der Welt danach“ verortet ist.
Julien ist nicht der einzige, der uns zur „Resilienz“ anregt. Ein Wort, das seit einigen Jahren in Mode ist, es hat den Anschein von Neuheit und man vergisst den Ursprung davon: Es wird in der Physik benutzt und sein Gebrauch ist nun gängig in der Psychologie und der Psychiatrie für Personen, die ein schlimmes Trauma erlitten haben, Deportierte, die überlebt haben, Strassenkinder, Waisenkinder, Schwerkranke – verletzliche Opferkategorien, die unfähig sind, in Bezug auf den Ursprung des Traumas zu handeln, da es schon stattgefunden hat, sie können nur seine Auswirkungen beeinflussen und brauchen Spezialisten, um es zu überwinden. Dieser Begriff ist also alles andere als neutral, wenn er auf Individuen, Gruppen oder Bevölkerungen angewandt wird, die somit zu einer passiven Rolle bestimmt sind. Ab sofort würden uns kleine „resiliente“ Gemeinschaften daran gewöhnen, das auszuhalten, was wir nicht verhindern könnten.
Zuvor forderte man uns dazu auf, einer durch eine jahrtausendealte Vergangenheit verbürgten Tradition zu gehorchen. Nun sollten wir uns einer schon präsenten Zukunft unterordnen.
Zuvor machte man sich über die Realitätsferne lustig, die Revolution für möglich zu halten und somit die Reform abzulehnen. Nun beschreibt man die Welt als unreformierbar. Verglichen mit den politischen Parteien (die Grünen eingeschlossen), die von sich behaupten, sie seien fähig, die Katastrophe zu verhindern, ist die kollapsologische Ambition gering: Uns mit dem Unvermeidbaren abfinden, zumindest für jene, welche überleben werden.
5) Glückliche Apokalypse
Genau wie als neue wissenschaftliche Transdisziplin, versteht sich die Kollapsologie als „spirituelle“ Vorgehensweise. New Age eines Todes der Welt, einer Religion ohne Gott, kündigt sie nichts weniger als eine Apokalypse an. In ihrer griechischen Bedeutung handelt es sich um eine Enthüllung. Die Apokalypse nach Johannes erzählt ein Ende der Zeit: „Da fielen Hagel und Feuer, die mit Blut vermischt waren, auf das Land. Es verbrannte ein Drittel des Landes, ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras.“ [21] Doch diese Vollendung eröffnet eine andere Welt: „Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen […]“ [22]
Im dem „Apostel Johannes“ zugeschriebenen Text war der Tod der Welt gleichbedeutend mit der Wiederauferstehung. Die Kollapsologen stünden eher in der Tradition der Propheten Israels, die dem jüdischen Volke im Falle des Ungehorsams Unheil versprachen.
Unabhängig davon, ob sie ein Kind des Alten oder Neuen Testaments ist, ähnelt die Kollapsologie einer religiösen Vision: Weil sie sich dem technologischen Grössenwahn auf Kosten der Natur hingegeben hat, muss das Menschengeschlecht für ihre Sünde büssen. Wenn die Hybris ein menschliches Verhalten darstellt, das von den Göttern als Masslosigkeit betrachtet wird, dann verdient es die Menschheit, bestraft zu werden, weil sie der Mässigung unfähig war.
Ursünde eines Menschen, der ein williges Opfer seiner Extravaganz ist (alles kennen wollen und glauben, alles tun zu können), Fall, Abgang aus dem Garten Eden (den man wiederfinden muss, der Zerfall der industriellen Zivilisation zwingt zu einem einfachen, naturnahen Leben), Ende der Welt, Erlösung, Regeneration durch die (somit heilbringende) Katastrophe, Gründung von Gemeinschaften „des Wartens“ vor dem Jüngsten Gericht über ökologische Sünden, die in Wirklichkeit Sünden des Stolzes sind – wir sind mitten im religiösen DIY, das so typisch für unsere Zeit ist.
6) (Sich) Angst machen
Ein neues Buch beschreibt Die unbewohnbare Erde, wo wir sehr bald „nach der Erderwärmung“ leben müssen. Es ist zu düster und übertrieben pessimistisch für die einen, realistisch und heilsam für die anderen, auf jeden Fall ist es ein Bestseller. David Wallace-Wells bekennt sich zu seiner Panikmache: Es ist besser, dem Publikum zu stark Angst zu machen als nicht genug. Die Angst ist ein guter Ratgeber, sie erlaube es, eine Dringlichkeit zu setzen, in Anbetracht welcher alles sekundär wird.
Doch das Spektakel der Krise und die Katastrophenszenarien verstärken den Eindruck der Ohnmacht. Was wir anschauen, spielt sich ausserhalb von uns ab, schlägt zu und entflieht; wir sind Opfer davon, und die Opfer erdulden, resignieren oder verlangen nach einem Beschützer. Je mehr man „vom Klima“ spricht, desto weniger handelt man, ausser um zu fordern, dass jene handeln, welche die Macht haben. In Anbetracht des Unvermeidbaren verlassen wir uns weiterhin auf andere und wir bestätigen uns in der Unfähigkeit, unsere Leben zu beeinflussen. Die Angst hemmt.
Übrigens, wenn die Fähigkeit der Menschheit, sich selbst zu vernichten, das Kriterium ist, hätte das Menschengeschlecht seit dem 16. Juli 1945, Datum der ersten atomaren Zerstörung, nie aufhören sollen, zu zittern. Günther Anders zog eine Linie von Auschwitz zu Hiroshima und einer todbringenden industriellen Modernität, die für ihn Manifestationen einer eintretenden oder sogar schon eingetretenen „Antiquiertheit des Menschen“ waren.
Ästhetisch ist der Glaube an ein Ende der Welt eine Quelle von Emotionen, wie jene, die man im Schloss Angers empfinden kann, wenn man den Ende des 14. Jahrhunderts erschaffenen Teppichzyklus der Apokalypse betrachtet. Politisch versuchte der Millenarismus von Thomas Müntzer und des Bauernkrieges, die gesellschaftliche Ordnung umzustürzen, um hier unten ein irdisches Paradies zu erschaffen. Die Apokalyptiker des 21. Jahrhunderts haben nur zum Ziel, uns eine Hölle zu vermeiden.
G.D., März 2021
Literaturverzeichnis
Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press, 1990.
Human Resource Use, Timing and Implications for Sustainability, 2009.
Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Wie alles zusammenbrechen kann, Mandelbaum, 2022.
Sehr gute Kritik der Kollapsologie: Jérémie Cravatte, L’Effondrement, parlons-en… Les limites de la collapsologie. Literaturverzeichnis, detailliertes Glossar.
David Wallace-Wells, Die unbewohnbare Erde. Leben nach der Erderwärmung, Verlag Ludwig, 2019.
Zur Religion in unserer Zeit: „Le Présent d’une illusion“, 2006.
Kollektiv, Apocalypse. La Tenture de Louis d’Anjou, Editions du Patrimoine, 2015.
Zum Millenarismus: Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, 1967, These 138.
Yves Delhoysie, Georges Lapierre, L’Incendie millénariste, Os Cangaceiros, 1987.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 07: Ökologie: Kapitalismus oder Kommunismus?
Die Behauptung mag abrupt erscheinen, sie ist jedoch notwendig: Die einzige Lösung für die zeitgenössische „ökologische Krise“ ist eine kommunistische Revolution. Wir müssen uns aber im Klaren darüber sein, was eine solche Revolution vollbringen würde, was voraussetzt, dass wir darauf zurückkommen, was der Kapitalismus ist.
1) Zu viele Definitionen
Bürokratischer, Staats-, Manager-, liberaler, neoliberaler, Monopol-, Rentier-, postindustrieller, thermo-industrieller, Konsum-, kognitiver, Trieb-, libidinöser, Spektakel-, patriarchaler, technokapitalistischer, Spät- (der Begriff wurde seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts benutzt), pharmapornographischer – und jetzt fossiler Kapitalismus. In allen Fällen ist die Bezeichnung wichtiger als das Bezeichnete. Was mutmasslich erlauben sollte, die Definition des Kapitalismus zu aktualisieren und zu präzisieren, wischt ihn im Gegenteil weg. Als ob die Anfügung die aufgrund seiner Unreife bisher verborgen gebliebene wahre Natur des Kapitalismus aufdecken würde. Jeder fügt eine Bezeichnung entsprechend seiner Fachgebiete und seiner theoretischen Affinitäten hinzu und die Liste wird ausgehend von unbestreitbaren, aber von einem Zeitgeist oder einer Mode als wesentlich proklamierten Realitäten länger.
So hat die Ökologie aus den ursprünglich neutralen oder positiven und in der Industrie gängigen Begriffen Produktivismus und Extraktivismus das gemacht, was den Kapitalismus charakterisiere und endlich den Weg für seine wahre Kritik öffne.
Damals hatte die Dekolonialisierung einen Dritte-Welt-Marxismus propagiert, heute interpretiert man den Kapitalismus angesichts der Frage der Geschlechter/Geschlechterrollen und dann der Rasse neu. Der ökologische Notstand ruft neue, auf als Totalität gedachten Teilbereichen basierende Theorien der kapitalistischen Produktionsweise ins Leben, denn die gesellschaftliche Realität ist heutzutage unfähig, die Gesamtheit, und somit die Grundlagen davon zu erfassen, was jedoch notwendig ist, um ihn zu transformieren und zu vernichten.
2) Klassen
Die Charakterisierung des Kapitalismus durch die Akkumulation und das Streben nach Profit erzeugt nicht notwendigerweise allzu viel Widerspruch, sogar mit einem Liberalen: Die Debatte fängt dort an, wo es um den Mechanismus dieser Akkumulation und dem geht, was mit dem Profit geschieht. Ihn ausgehend vom Verhältnis Kapital/Arbeit zu definieren, ist schon weniger akzeptiert. Aber es zu wagen, die Worte „Bourgeois“ und „Proletarier“ zu benutzen, gilt als Ideologie, als alter Marxismus, fast schon als Arbeiter-Marxismus.
Man kann eine Veranschaulichung davon in einem im Übrigen achtbaren Buch lesen: The Human Planet. How We Created the Anthropocene. Simon Lewis und Mark Maslin beschreiben darin die „entscheidende Veränderung“ von einer ländlichen und landwirtschaftlichen Lebensweise hin zu einer „vom Profit geleiteten“ Gesellschaft. Doch die Einnahme und die Akkumulation von Geld existierte als Praxis schon lange vor der kapitalistischen Produktionsweise. Die von ihr eingeführte Neuigkeit ist die Vorherrschaft der Akkumulation von Geld zum Zweck der Investition und nicht einfach, um sein Vermögen zu geniessen. Das Unternehmen (und nicht nur der individuelle Unternehmer, siehe unsere Episode 2, § 2) investiert, um mehr Profit zu erzielen und beginnt auf einer höheren Ebene unter dem Anreiz der Konkurrenz erneut damit.
Doch gemäss Simon Lewis und Mark Maslin seien wir von „einer von einer für den ganzen Planeten eine Bedrohung darstellenden Technologie geleiteten Elite“ beherrscht: Sie erkennen die Existenz von Klassen und „Klassengrundlagen der aktuellen Lebensweise“ an, aber ziehen daraus nicht den Schluss eines dynamischen Verhältnisses, welches das gesellschaftliche System hervorbringt, es sich entwickeln lässt und zerstören könnte, denn für sie ist der Motor der Geschichte die Kombination von Energie, Technik und Information. Arbeiter und sogar eine „industrielle Arbeiterklasse“ existieren freilich, aber verschmolzen „im Volk/in den Leuten“ (people), was für sie der Schlüsselfaktor ist.
Das Nachdenken über die kapitalistische Produktionsweise ohne die Behandlung der Klassen oder über die Klassen ohne die Berücksichtigung des Klassenkampfes ist ein Rückschritt, sei es nur im Verhältnis zu den bürgerlichen Historikern der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert (die an das Thema selbstverständlich nicht als Sozialisten oder Kommunisten herangingen).
Aber es reicht auch nicht, den Kapitalismus durch die Ausbeutung der Proletarier durch die Bourgeois zu definieren. Diese Ausbeutung muss auch von jener der Sklaven, der Leibeigenen usw. unterschieden werden (die Sklaven haben ihre Herren nicht gestürzt, genauso wenig die Leibeigenen). In der kapitalistischen Produktionsweise ist es eben genau die Ausbeutung, in diesem Fall der Widerspruch Kapital/Arbeit, die es möglich macht, ihr Ende in Betracht zu ziehen. Das ist der Sinn und Zweck des Manifests von 1848, sonst wären Marx und Engels zur Verbesserung der Dinge engagierte Soziologen oder Philosophen, wie so viele andere ihrer und unserer Zeitgenossen, ohne Anspruch, zu einer kommunistischen Theorie beizutragen.
Es geht nicht darum, auf den Klassen zu beharren, um einem Dogma treu zu bleiben. Wenn man die Existenz einer Bourgeoisie, deren Interessen „naturgemäss“ jenen der Proletarier widersprechen, nicht wahrnimmt, versteht man das zu überwindende Hindernis nicht und auch nicht, wie man es überwinden kann. Im besten Falle ruft man zu einer Demokratisierung auf, die „der Oligarchie“ ihre Macht nehmen oder sie verringern würde. Im schlimmsten Falle, weil „wir alle im gleichen Boot sind“, verlässt man sich auf den guten Willen aller.
3) Produktivität
Was macht die aussergewöhnliche Kraft der kapitalistischen Produktionsweise aus? Das Streben nach Produktivität und sie erklärt die Produktion für die Produktion. Die Produktion für den Profit ist gleichbedeutend mit der Einsparung – durch ihre systematische Verringerung – von Arbeit. Was voraussetzt, die Zeit und, ausgehend davon, alles zu zählen. Aber wo wird diese Produktion organisiert? In jener nicht minder wesentlichen Realität des Kapitalismus, dem Unternehmen: Das Kapital ist eine unpersönliche Macht, obwohl sie von menschlichen Wesen verwaltet wird, steht sie über ihnen. Hier liegt die Grundlage jenes Systems, das es zu vernichten gilt: Es in den Dienst einer anderen Politik, einer anderen Entwicklung oder eines anderen Wachstums zu stellen, wird nur die Oberfläche davon verändern.
Das Wort Produktivismus führt in die Irre. Dieses System produziert nicht, um zu produzieren, sondern um Wert zu akkumulieren, nicht durch eine Bewegung, die autonom geworden wäre, sondern durch die produktive Arbeit. Natürlich zugunsten jener Klasse, welche davon profitiert; doch die Bourgeoisie ist nur der Agent davon, nicht die Ursache. Andererseits, obwohl eine „Konsumgesellschaft“ sehr wohl existiert (auf einem Niveau, das sich Marx schwer hätte vorstellen können), basiert der Kapitalismus auch nicht auf dem Konsum für den Konsum. Er ist eine Auswirkung davon.
Was in dieser Produktionsweise am sichtbarsten und auch sehr wohl real ist, definiert ihn jedoch nicht – die Hyperproduktion genauso wenig wie der Hyperkonsum. Sonst würde „Antikapitalismus“ nur bedeuten, gegen seine Exzesse zu kämpfen und zur Mässigung anzuregen (die Uneinigkeit betrifft nur die Mittel: Begrenzung des Kapitalismus durch die Wahl, die Strassenaktion oder die Schaffung einer alternativen Wirtschaft, die als gutes Beispiel fungiert).
4) Zwei Widersprüche? Oder: Ist die Natur eine historische Kraft?
Im Verlauf des 20. Jahrhundert kamen einige Ungeduldige, die in Anbetracht eines Kapitalismus, der weiterhin wächst und die Welt beherrscht, den Widerspruch Kapital/Arbeit als historisch ungenügend und theoretisch inadäquat beurteilten, zum Schluss, dass man einen anderen finden muss, dessen Anfügung es endlich erlauben würde, die Geheimnisse des Kapitalismus zu verstehen und ihn leichter abzuschaffen.
Auf eine ganz andere Weise haben seit den 1980er Jahren diverse Marxisten, besonders James O’Connor, die These eines „zweiten Widerspruchs des Kapitalismus“ dargelegt: Zu jenem zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen fügen sie einen weiteren hinzu, jenen zwischen der Produktionsweise und ihren materiellen Bedingungen, insbesondere der Natur.
Als Marx, um uns auf ihn zu beschränken, von Widerspruch sprach, tat er das, um jene Dynamik zu bezeichnen, welche ein gesellschaftliches System antreibt, sich entwickeln lässt und es zerstören kann, in diesem Fall in der kapitalistischen Produktionsweise der Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und/oder zwischen Lohnarbeit und Kapital. Dieses „und/oder“ ist notwendig, denn das Marxsche und später marxistische Denken hat die beiden Gegensätze weitgehend miteinander assimiliert, als ob das Proletariat der Träger jener Produktivkräfte wäre, welche es sich aneignen würde, um sie zugunsten aller gegen die Bourgeois als Verteidiger der Produktionsverhältnisse im Dienste ihrer Interessen zu entwickeln. Zu Marx und dem Marxismus, siehe unsere Episode 1, § 4.
O’Connor übernimmt diesen Widerspruch, aber schliesst die Natur in die Produktivkräfte mit ein. Marx, erklärt er, wusste, dass die kapitalistische Land- und Forstwirtschaft die Natur zerstören, doch er hatte nicht verstanden, dass die Zerstörung der Natur (unendlich viel schlimmer im 20. als im 19. Jahrhundert) ein starker Faktor für die Verringerung der Profite und Akkumulationsmöglichkeiten sei, dermassen, gemäss O’Connor, dass sie einen strukturellen Widerspruch in dieser Produktionsweise darstellt.
Für Marx handelte es sich tatsächlich nur um zusätzliche Zwänge für das Kapital. Ricardo hingegen unterstrich die Verringerung des Profits aufgrund der sinkenden landwirtschaftlichen Erträge, da notwendigerweise weniger fruchtbare Böden genutzt werden mussten. Im 19. Jahrhundert (Ricardo starb 1823) blieb die Landwirtschaft, sogar im Land, das die Industrierevolution angetrieben hatte, sehr wichtig. Im Kapital schliesst die kurze Passage über die Klassen im Buch III „die Grundeigentümer“ in „die drei großen Klassen der modernen […] Gesellschaft“ neben den „Lohnarbeiter[n]“ und den „Kapitalisten“ mit ein.
Alles hängt vom Sinn ab, den man „Widerspruch“ gibt. Jener, welche Bourgeois und Proletarier einander entgegensetzt, strukturiert den Kapitalismus und kann eines Tages zu seiner Zerstörung führen. Wenn der Kapitalismus hingegen seine „natürlichen“ Grundlagen – die er tatsächlich tendenziell so behandelt, als ob sie fast gratis und unerschöpflich wären – ruiniert, erschüttert und bedroht das seine Profite, erschwert die Aktivität gewisser Sektoren und wird andere ruinieren, doch stellt nicht seinen Fortbestand als System infrage. Er wird die sozio-ökologische Krise auf seine Weise (zerstörerisch für die Natur und katastrophal für die Proletarier) lösen, ohne sich jedoch selbst zu zerstören. Man könnte sagen, dass diese Entwicklung „alles verändert“, ausser dass es sich nicht um einen Widerspruch handelt, der die Grundlage der Produktionsweise berührt.
Zudem erweitert James O’Connor den Agenten der gesellschaftlichen Veränderung jenseits der Lohnarbeit und sieht eine sich abzeichnende Einheit zwischen „der Arbeiterbewegung“, „dem Feminismus, den Umweltbewegungen“, „den neuen sozialen Bewegungen“, „der fast universellen Volksbewegung zum Schutz der Produktionsbedingungen“ und zur „Demokratisierung des Staates“. Er deutete 1988 an, was seither theoretisiert worden ist: Der „Klassenwiderspruch“ sei nur einer unter anderen, jener der Geschlechterrollen, der Rasse – wieso also nicht eine als zur Mobilisierung der Massen vorausgesetzte Bewegung „für das Klima“ hinzufügen? Jeder auch nur ein bisschen wichtige Protest, jede Revolte wird nun als strukturierender Widerspruch des Kapitalismus wahrgenommen und aufgrund seiner Fähigkeit beurteilt, die Massen auf die Strasse zu bringen. Allem, dem man sich widersetzt, wird zwingend die Definition eines so weit wie möglich dehnbaren Kapitalismus gegeben, jeder Kampf sei antikapitalistisch. Viele Autoren bemühen sich übrigens so stark wie möglich, nicht den Eindruck zu geben, die Kämpfe und somit die daran teilnehmenden „Leute“ zu hierarchisieren. Es gebe keinen gesellschaftlichen Schwerpunkt mehr: Das Zentrum sei jetzt überall.
Im Grunde genommen betrachtet O’Connor die materiellen Produktionsbedingungen als historische Kraft, deren Handlung, genau wie jene der Gesamtheit der Produktivkräfte, eine Auswirkung auf die kapitalistischen Produktionsverhältnisse habe. Doch was tut die Natur? Die Erde beschränkt sich darauf, sich dem anzupassen, was sie erduldet (mit ein bisschen Fantasie könnte man sie „resilient“ nennen). Eine wie auch immer geartete historische Kraft trifft Entscheidungen, wählt zwischen verschiedenen und entgegengesetzten Optionen, sie ist auch fähig, sich zu täuschen, sie tut mehr als nur auf sie in eine einzige Richtung drängende Anreize und Zwänge zu reagieren. Das gilt nicht für einen Wald, einen Gletscher oder ein Ölfeld. Unter den Produktivkräften hat nur das Proletariat eine gesellschaftliche Existenz und kann somit als historisches Subjekt handeln.
5) Industriegesellschaft oder kapitalistische Gesellschaft?
Regiert die Technik die Welt?
Verfügt die Bourgeoisie über das Monopol über die Technologie oder über die Produktionsmittel? Gewiss beides, doch ersteres ergibt sich aus zweiterem.
Anders gesagt, ist die kapitalistische Produktionsweise zuerst und allen voran ein Technokapitalismus?
Es ist eine Tatsache, dass „die Marxisten“ stark dazu tendierten, die Technik als gesellschaftlich neutral zu betrachten, als ein Instrument, dass sich die Proletarier aneignen würden, indem sie es weitertreiben und in den Dienst der Menschheit statt einer Minderheit stellen würden. Aber es reicht nicht, den marxistischen Mangel ausfindig zu machen. Man muss den Kern dieser Produktionsweise und das betrachten, was seine Führungsschicht ausmacht und unterhält. Die Bourgeois beherrschen die Technik, weil sie die gesellschaftliche Teilung beherrschen, die sie über die Produktionsmittel verfügen lässt, und nicht umgekehrt: Die Experten, Ingenieure, Gelehrten, Technokraten usw. regieren die Welt nicht. Der Bourgeois ist nicht ein Modernisator aus Prinzip: Es sind die Konkurrenz mit seinen Rivalen und der Kampf gegen den Widerstand der Lohnarbeiter, die ihn gestern zum Maschinenbetrieb und heute zur Digitalisierung gedrängt haben. Die Funktionsweise des MIT ist mit jener von Wall Street verbunden, was nicht bedeutet, dass ersteres im Dienste letzterer steht, und auch nicht, dass, wenn wir uns letzterer entledigen, ersteres endlich dem Gemeinwohl dienen würde.
6) Von der kapitalistischen Innovation
Die kapitalistische Produktionsweise definiert sich nicht durch die Arbeit (die schon lange vor ihr existierte), sondern durch die Lohnarbeit, deren Existenz die Trennung des Arbeiters von den Arbeitsmitteln voraussetzt. Seit einigen Jahrzehnten ist es eine globale Tatsache: Der beschleunigte Niedergang der Selbstversorgung und der Nahrungsproduktion hat mehr als die Hälfte der Menschheit in den Städten zusammenströmen lassen, dort hat der „Reservelose“ keine anderen Ressourcen, um zu leben, als von einem Chef angestellt zu werden, insofern er es kann. In den entwickelt genannten Ländern oder Regionen betrifft die Lohnarbeit die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung: Sogar die „liberalen“ Berufe (die juristischen z.B.) stellen eine bedeutende Menge an entlohntem Personal an und die meisten „Kleinunternehmer“ werden von einem Chef beherrscht, der ihnen die Rolle des Lohnarbeiters ohne den durch diesen Status garantierten relativen Schutz aufzwingt. Die Arbeitsteilung (die Teilung in Klassen) hat nicht auf den Kapitalismus gewartet, aber nur er entwickelt eine Gesellschaft, wo alle zum Verkauf (für die Proletarier) oder zum Kauf (für die Bourgeois) von Arbeitskraft tendieren.
Das Geld charakterisiert den Kapitalismus auch nicht. Alles ist eine Frage des Ausmasses: Ab welcher Schwelle ist ein Phänomen mächtig genug, um eine Gesellschaft zu strukturieren? Es gab schon früher Handelsklassen: Im ersten Band von Die grossen Strömungen der Weltgeschichte (1944) machte Jacques Pirenne sogar eine Bourgeoisie im antiken Ägypten aus, da das Einkommen einer gesellschaftlichen Gruppe nur vom Handel kam. Ein aus dem Ruder gelaufener Finanzmarkt und die Spekulation sind keine neuen Phänomene: Holland erlebte seine „Tulpenkrise“ im 17. Jahrhundert. Die kapitalistische Neuheit ist die Tatsache, dass die Arbeit eine Ware ist, deshalb tendiert alles dazu, zu einer Ware zu werden, und die Beziehungen tendieren immer mehr dazu, durch Geld vermittelt zu werden. Es ist möglich, ausserhalb des Stromnetzes (off the grid), aber fast unmöglich, ausserhalb des Geldnetzes zu leben. Die alternativen Gemeinschaften, die ohne Geld leben wollen, schlagen sich in Tat und Wahrheit mit sehr wenig davon durch (soziale Mindestsicherung, kleine Ersparnisse, von Freunden zur Verfügung gestelltes oder durch den Verkauf einiger Produkte erworbenes Geld).
Lohnarbeit und Kapital treffen im Unternehmen aufeinander (siehe unsere Episode 2, § 2). Jedes davon ist durch die Konkurrenz gezwungen, seine Produktivität zu steigern, um mehr Wert zu akkumulieren als seine Rivalen. Wachstum ist ein Zwang und damit jene Phänomene, welche im industriellen Kapitalismus systematisch geworden sind: permanente Innovation, geplante Obsoleszenz, Überproduktion, Überakkumulation – mit ihren Auswirkungen auf die Proletarier und die Natur.
7) Ein bisschen Geschichte
Die durch die Kontroverse „Anthropozän oder Kapitalozän“ neu lancierte Debatte über die Periodisierung der kapitalistischen Produktionsweise dreht sich in Wirklichkeit um ihr Wesen.
Gemäss gewissen Anhängern des Kapitalozäns wäre die Industrielle Revolution (Ende des 18. Jahrhunderts in Europa) ohne den „Handelskapitalismus“ (seit dem 16. Jahrhundert) unmöglich gewesen, d.h. ohne die koloniale Expansion und die Ausbeutung anderer Kontinente.
Es ist wahr, dass der Kolonialhandel (besonders die Einkommen aus dem Sklavenhandel und der Zuckerproduktion) die Anhäufung von danach in die Textilindustrie investierten Vermögen erlaubt und die Nachfrage nach Fertigwaren begünstigt hat. Doch man muss in der Geschichte noch weiter zurückgehen. Die These der Zentralität des transatlantischen Handels in der Industriellen Revolution verkennt die vorherige Notwendigkeit einer „industriellen“ Kapazität (und Überlegenheit) zur Sicherstellung der Beherrschung der Meere. Zuvor war man gezwungen, Vermögen durch innereuropäischen Handel zu akkumulieren, von Tüchern allen voran, der seinerseits eine höhere Produktivität der Landwirtschaft und des Handwerks im Norden Italiens, Flandern, England, Frankreich und Spanien voraussetzte. Zirkulation setzt eine Produktion voraus. Die (enormen) kolonialen Profite reichen nicht aus als Erklärung für die Tatsache, dass im England Ende des 16. Jahrhunderts die Produktivität eines Landarbeiters um 90% im Vergleich zu den zwei vorhergehenden Jahrhunderten oder der Ertrag pro Acker (0.4 Hektare) Getreide zwischen 1600 und 1750 um 50% ansteigt.
Der Industriellen Revolution war eine Revolution der „Arbeitsamkeit“ vorausgegangen, während welcher mehr oder weniger alles zur Ware wird. Vor der Expansion des Lohnarbeitsmarktes war ein Pachtmarkt errichtet worden: Um das Land zu bearbeiten, lässt der Grundeigentümer Landwirte gegeneinander konkurrieren und stellt den produktivsten davon an, letzterer wird seinerseits seine Landarbeiter dazu drängen, einen maximalen Profit zu liefern. Indien und China sind damals auch zu einer ertragreichen Landwirtschaft fähig, aber nur in gewissen entwickelten Gebieten: Diesen Ländern mangelt es an einem wettbewerbsfähigen Markt auf einem Territorium, das von einem relativ stabilen und vereinigten Nationalstaat beherrscht wird, der stark genug ist, um eine weiter entwickelte Steuerharmonisierung als seine Rivalen einzuführen (Frankreich wird erst nach 1789 ein einheitliches Steuersystem haben). Das Kapital wird auch zur Ware (der erste Aktienmarkt entsteht in Amsterdam am Anfang des 17. Jahrhunderts).
Der industrielle Kapitalismus hätte nicht existiert und sich nicht so entwickelt, wie er es getan hat, ohne den durch den Handelskapitalismus, besonders dank der Profite der Sklaverei, akkumulierten Reichtum. Es war darüber hinaus notwendig, diese Sklaven gegen die konkurrierenden Länder zu holen und zu transportieren, in einer langen militärischen und wirtschaftlichen Konfrontation zwischen der britischen, englischen, holländischen, spanischen und französischen Marine, bis England definitiv als Sieger davon hervorgeht. Ein Kriegsschiff der Royal Navy im 17. Jahrhundert ist ein Navigations- und Kampfsystem (z.B. etwa Tausend Rollenverschraubungen, die alle fünf Jahre gewechselt werden müssen), das nur für jene Länder erschwinglich ist, welche zu dem fähig sind, was man heute eine „Waffenindustrie“ nennen würde (Venedig war die erste Seemacht gewesen, welche die Schiffsteile standardisiert hatte), und mit einer gesellschaftlichen und technischen Kapazität zu einer „Spitzentechnologie“, wie es heute ein Rafale-Flugzeug oder eine Predator-Drohne sind.
In einigen Jahrzehnten hat sich die Interpretation der Herausbildung des modernen Kapitalismus geändert. Man mindert die Rolle der Industriellen Revolution (eine Tendenz, die wahrscheinlich mit dem Niedergang der Arbeiterbewegung in den früheren kapitalistischen Metropolen zusammenhängt) und man überschätzt jene dessen, was ihr vorausgegangen ist: Entstehung der Bank, koloniale Ausbeutung, Sklaverei, Unterwerfung der Frauen. Die Entstehung des industriellen Kapitalismus wurde von der Sklavenarbeit begünstigt, aber seine Expansion ging mit dem Ende des Sklavenhandels und dann der Abschaffung der Sklaverei einher und errichtete sich auf der Grundlage der „freien“ Arbeit, der Lohnarbeit, welche die ganze Einzigartigkeit dieser Produktionsweise ausmacht. Darüber hinaus erklärt der Sklavenhandel nicht die industrielle Entwicklung Deutschlands oder die Tatsache, dass die grossen französischen Sklavenhäfen nicht zu industriellen Zentren geworden sind. Ohne den transatlantischen Handel hätte es freilich keine Auslösung der Industriellen Revolution gegeben, aber die strukturelle Grundlage des Kapitalismus ist das Verhältnis Kapital/Lohnarbeit, das seit der Renaissance existierte, aber erst mit der Industrialisierung das gegenwärtige Ausmass erreicht.
8) Krise
Wie am Ende unserer zweiten Episode erwähnt, ist die ökologische Krise Teil der Rentabilitätskrise. Der zeitgenössische Kapitalismus tendiert dazu, eine seiner Profitquellen auszutrocknen, nämlich die Natur. Diese „abnehmenden Erträge“ evozieren, was Ricardo 1817 darlegte und durch den Zwang zur Bebauung weniger rentabler Böden erklärte.
Doch das Phänomen unterscheidet sich von jenem, das vor zwei Jahrhunderten theoretisiert worden war. Am Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts ist der Preis für die aussergewöhnliche Ertragssteigerung pro Hektare („die grüne Revolution“) die nicht minder enorme Steigerung der „Einträge“ (Dünger, Pestizide…) und die geringere Rentabilität des Bodens ist auch einer Verschlechterung der natürlichen Gleichgewichte geschuldet, diese war kaum konzipierbar vor zweihundert Jahren, ausser man war Visionär wie Fourier.
Die kapitalistische Produktionsweise – und somit die Bourgeoisie, die sie verwaltet – stolpert über die Tatsache, dass sie die Arbeit (den menschlichen Faktor) nicht auf Wert, auf Zeit, auf Flüsse reduzieren kann, doch das gilt auch für die natürlichen Faktoren. Es gibt weder eine Anthropomorphose des Kapitals, noch seine „Naturalisierung“, es unterwirft weder die Arbeit, noch die Erde, weder den Menschen, noch die Natur je komplett, genauso wenig, wie die Bourgeois die prometheische und zerstörerische Extravaganz, deren Agenten und Begünstigte sie sind, beherrschen.
Wir sind in eine „globale“ Krise eingetreten, sie ist bedingt durch gesellschaftliche und politische Widersprüche, die eine Ausschöpfung der Rohstoffe, steigende Kosten für Energie, Umweltschäden, Vertiefung der interimperialistischen Rivalitäten und verstärkte geopolitische Destabilisierung verschlimmern.
Die Geschichte lehrt uns, dass gesellschaftliche Explosionen und sogar Klassenkämpfe in etliche und einander entgegengesetzte Sackgassen und Abstellgleise münden können. Bis jetzt weist nichts darauf hin, dass die gegenwärtigen defensiven und offensiven proletarischen Handlungen auf allen Kontinenten mechanisch zu einer Infragestellung und einem Sturz des Verhältnisses Kapital/Arbeit führen. Falls es in dieser Situation zu einer bedeutenden sozio-ökologischen Katastrophe kommen sollte (wie einem neuen Tschernobyl in Europa, einer aussergewöhnlichen Hitzewelle oder einer sehr mörderischen Pandemie), würde der Staat darauf, wie während dem Hurrikan Katrina, mit sowohl gesundheitlichen als auch repressiven Notlösungen antworten.
9) Kommunismus
Wir werden uns hier damit begnügen, schnell die Schlüsse aus der weiter oben und in mehreren vorangehenden Episoden skizzierten Definition der kapitalistischen Produktionsweise zu ziehen. Einige etwas lange Zitate werden notwendig sein, um uns im Verhältnis zu einer Perspektive zu situieren, die Marx in dem zusammengefasst hat, was häufig als Schlussfolgerung des dritten Bandes betrachtet wird: „Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden […] Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.“
Der Ökosozialist Paul Burkett fasst eine Marxsche und marxistische Vision gut zusammen, sie wird häufig auch auf verschiedene Arten von Anarchisten geteilt: Im Gegensatz zum Kapitalismus, der Produzenten und Produktionsmittel voneinander trennt, wird der Sozialismus/Kommunismus sie vereinen, indem „er die Arbeitskraft dekommodifiziert […] Die kommunistische oder ‚assoziierte‘ Produktion ist geplant und wird von den Produzenten und Gemeinschaften selbst realisiert, ohne die durch die Klassengesellschaft auferlegten Vermittlungen: Lohnarbeit, Markt und Staat.“ Gemeineigentum und assoziierte Arbeit werden den durch den Kapitalismus unterbrochenen Stoffwechsel der Beziehungen zwischen dem Menschengeschlecht und der Natur wiederherstellen. Zitieren wir auch Michel Husson: „[D]ie Gefahr grosser planetarer Unordnung ist eigentlich unermesslich […] und ihre Kosten unendlich. Das gewöhnliche wirtschaftliche Kalkül ist nutzlos geworden, sodass ein radikaler Bruch notwendig ist. Wir müssen die Sphäre des Krämerkalküls überwinden.“
Aber das alles, um weiterhin zu berechnen, wenn auch nicht mehr wie ein Krämer?
Wenn die kapitalistische Produktionsweise das leistungsfähigste je erfundene gesellschaftliche System zur Reduzierung der Produktionskosten ist, dann verdankt sie es besonders der methodischen Buchführung über die Arbeitszeit, die sich in der modernen Obsession für „gewonnene“ oder „verlorene“ Zeit widerspiegelt. Könnte eine vom Kapitalismus befreite Gesellschaft weiterhin eine systematische Berechnung der Produktionszeit als einfaches Instrument der rationalen (und gerechten) Verwaltung praktizieren, ohne genau dadurch die Produzenten und Produzentinnen, sogar brüderlich und schwesterlich, dazu zu drängen, rentabler zu werden, wie heute, ausser dass sie glauben würden, sie täten das in ihrem Interesse? Mit der unvermeidbaren Konsequenz, dass sich dieser Druck auch auf die materiellen Bedingungen ihrer Produktion auswirken und zu einer Überausbeutung der Natur führen würde?
Im 19. Jahrhundert ging Engels vielleicht diesbezüglich am weitesten. Er betrachtet die Zeit als „natürliche[s], adäquate[s], absolute[s] Maß“ der Arbeit und macht daraus den Regulator einer gemeinschaftlichen Produktion: Wenn jedoch, erklärt er, 100 m² Stoff 1‘000 Stunden Arbeit benötigten, bedeutet das nicht, „sie seien tausend Arbeitsstunden wert“, denn ihre Produktion werde nur durch „[d]ie Nutzeffekte der verschiednen Gebrauchsgegenstände, abgewogen untereinander und gegenüber den zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmengen“ bestimmt [23].
Für Engels und die Marxisten, die seine Analyse übernehmen, hätte diese Berechnung der Arbeitszeit nichts mehr mit den kapitalistischen Berechnungen zur stetigen Kostenreduzierung, also zur maximalen Senkung der Löhne und der Vernachlässigung der Auswirkungen der Produktion auf die Natur, zu tun. Weshalb? Weil es, ihrer Meinung nach, die nun assoziierte und bewusst organisierte Arbeit erlaubt, die nötigen Arbeitsmengen vor der Produktion zu kennen, zu messen und vorherzusehen, um die menschlichen und materiellen Mittel zur Befriedigung der gemeinsam durch Kollektive von Produzenten entschiedenen Bedürfnisse aufzuteilen. So würde der Kommunismus die verfügbaren Ressourcen tangieren, berechnet in Anzahl Ziegelsteine, Kilos Karotten und Metern an Stoff, und auch in Arbeitsstunden.
Aber kann man zugleich physische Mengen (den physischen „Nutzeffekt“) und Qualität (den in Zeit bewerteten „Arbeitsaufwand“) zählen?
Lange vor dem Anti-Dühring und 20 Jahre vor dem Kapital bekräftigte Marx: „In einer künftigen Gesellschaft, wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine Klassen mehr gibt, würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der Produktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den verschiedenen Gegenständen widmet, würde bestimmt werden durch ihre gesellschaftliche Nützlichkeit.“ [24]
Mehr als zwei Jahrhunderte, unter einem allgegenwärtigen Kapitalismus, der aber auch durch neue Kämpfe wie die „Anti-Arbeit“ der 1970er Jahre infrage gestellt wird, ist es möglich, die Frage neu zu denken.
Obwohl es wahr ist, dass jede Gesellschaft messen, vergleichen (und vorhersehen) muss, folgt daraus nicht, dass diese Einschätzungen zwingend mit Äquivalenzrelationen, wie man sie zwischen Waren im Verlauf des Tausches erstellt, einhergehen müssen. Es ist der Kapitalismus, der, um über reelle und diversifizierte, geleistete oder vorhergesehene Anstrengungen Rechenschaft abzulegen, alles mit allem vergleichen können und somit über ein allgemeines Mass, die Arbeitszeit, verfügen, alles in Zeit zählen und unter der Herrschaft der Zeit und der Kontrolle der Stunden und Sekunden leben muss. Das Streben nach einem Kriterium, das es erlaubt, jedes Ding mit jedem anderen Ding zu vergleichen, widerspiegelt die Welt des Werts, wo jede Aktivität und jedes Objekt entlang einer einheitlichen Berechnungsgrundlage eingereiht werden müssen, unabhängig von ihrem eigentlichen Wesen und der zu ihrer Hervorbringung spezifischen Anstrengungen.
Falls man ein Beispiel will, ist die Digitalisierung der Welt eklatantes Anschauungsmaterial dafür. Unsere Zeitgenossen sind verwirrt aufgrund der stets wachsenden aussergewöhnlichen Überfülle an zirkulierenden Daten im Cyberspace: Jeden Tag werden fast drei Milliarden Mails verschickt und 700‘000 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Doch die erste Tatsache, die uns erstaunen sollte, ist, dass alles auf vergleichbare, messbare und transportierbare Einheiten reduziert wird: Das Babyfoto, der Artikel des Guardian, die Bilder der Demo und der Gesang des Didon werden in Nullen und Einsen verwandelt, natürlich virtuell, aber es ist eine Virtualität, die immer mehr als so real wie die Realität erlebt wird, wenn nicht noch mehr.
Was in einer Revolution aus dem Internet werden würde, weiss niemand. Vielleicht werden Liebhaber weiterhin Lust und die Möglichkeit haben, sich augenblicklich Nachrichten von einem Kontinent zum anderen zu schicken (unter der Bedingung, dass es genug Elektrizität gibt für diese Art von Aktivität und genügend freiwillige Techniker, um ein solches planetares Netzwerk zu unterhalten). Nehmen wir trotzdem an, dass eine andere Menschheit es leid wird, alles über alles mit einem Klick zu wissen und ihre Meinung wozu auch immer abzugeben. Wie es auch immer sein mag und insofern es heute möglich ist, sich davon ein Bild zu machen, wird der Kommunismus nicht danach streben, jede Praxis und jedes Objekt auf das zu reduzieren, was sie mit anderen gemeinsam haben, und darauf, wie sie mit anderen austauschbar sind. Er würde sich mit der Befriedigung qualitativ anderer Bedürfnisse befassen. Er würde die verfügbaren Mittel einschätzen und zählen, ohne sie dafür alle (Rohstoffe, Werkzeuge, menschliche Fähigkeiten…) gemäss einer gemeinsamen Essenz, die aus der zu ihrer Produktion notwendigen, mittleren Arbeitszeit bestünde, zu bemessen.
Lewis Mumford zeigte 1934 auf, wie die Zeitmessung dazu gekommen war, unsere Welt zu beherrschen und sah in der mechanischen Uhr, noch mehr als in der Dampfmaschine, die Schlüsselerfindung der Industriellen Revolution: „Die Uhr ist ein Antriebsmechanismus, dessen ‚Produkt‘ Sekunden und Minuten sind.“
Dieser Umweg hat uns nicht von der Ökologie entfernt, denn es gibt Arten, die Welt zu betrachten, die einem daran hindern, sie zu verstehen. Es gibt ein logisches und notwendiges Verhältnis zwischen der Ausbeutung des Proletariers und der zerstörerischen „Verwertung“ Amazoniens. Wenn der Kapitalismus systematisches Streben nach Reduzierung der Kosten und der zur Produktion notwendigen Arbeitszeit ist – was nicht zu einem geringeren Arbeitsaufwand führt, dieser wird im Gegenteil immer mehr verdichtet –, geht das mit einer Buchführung der Arbeitszeit einher, die somit nicht eine der Grundlagen des Kommunismus sein kann. Um dem bürgerlichen Durst nach Profit und seinen zerstörerischen Konsequenzen für den Planeten ein Ende zu bereiten, bricht die Revolution mit der Obsession für den Ertrag, dessen Agent der Bourgeois ist. Ökologie und Produktivität sind inkompatibel.
G. D., April 2021
Literaturverzeichnis
Simon L. Lewis, Mark A. Maslin, The Human Planet. How We Created the Anthropocene, Pelican, 2018.
Marx und die Klassen: Fragment „Die Klassen“, über die drei „großen Klassen der modernen […] Gesellschaft“, dabei ist festzuhalten, dass das Grundeigentum immer kapitalistischer wird: Das Kapital, Bd. III in MEW, Bd. 25, S. 892-893.
James O’Connor (1988 mit Barbara Laurence Gründer der Zeitschrift Capitalism, Nature and Socialism): Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction, 1988.
Zur Arbeit: De la Crise à la communisation, Entremonde, 2017, Kap. 3, § 2.
Und: Travail : L’enjeu des 7 erreurs, 2017.
Zur gegenwärtigen kapitalistischen Krise:
De la Crise à la Communisation, Entremonde, 2017, Kap. 4.
Und die abschliessenden Kapital von Bruno Astarian & Robert Ferro, Ménage à trois, Asymétrie, 2019.
Marx zu den „assoziierten Produzenten“: Das Kapital, Bd. III in MEW, Bd. 25, S. 828.
Marx, Das Elend der Philosophie (1847), Kap. 1, § 2.
Engels, Anti-Dühring, 1878, dritter Teil, „Sozialismus“, Kap. 4.
Lewis Mumford, Technics and Civilization, 1934.
Communisation, 2011.
Bruno Astarian, Activité de crise & communisation, 2010.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
Episode 08: Auf verlorenem Posten?
The ice age is coming, the sun is zooming in_ Engines stop running, the wheat is growin’ thin_ A nuclear error, but I have no fear.The Clash, London Calling, 1979
Ein spanischer Gewerkschaftsaktivist sagte 1922: „Wenn wir uns doch nur die Produktionsmittel hätten aneignen können, als das System jung und schwach war, dann hätten wir es langsam zu unserem Vorteil entwickeln können, indem wir aus der Maschine den Sklaven des Menschen gemacht hätten. Jeder Tag, den wir warten, macht die Sache schwieriger.“
Hundert Jahre sind vergangen. Ohne schnelle Umkehrung der gegenwärtigen Tendenzen wird der mittlere Anstieg der Temperaturen 2° C im Verlauf unseres Jahrhunderts betragen, die Folgen davon werden katastrophal sein und die Regierenden darauf mit einer Mischung von Verweigerung, läppischer Reform und verschlimmerter Repression antworten. Ist es vielleicht schon zu spät?
1) Kein Klimadeterminismus
Ein grosser, nicht allzu weit zurückliegender Klimawandel ist allseits bekannt, die „Kleine Eiszeit“ vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, die ihren Höhepunkt zwischen 1570 und 1730 erreicht: Sie war eine Katastrophe für die Ernten und habe einen Drittel der Menschheit im 17. Jahrhundert getötet (600‘000 Tote in Frankreich während des „grossen Winters“ 1708-1709).
Eine Lehre aus dieser schrecklichen Erfahrung ist, dass der entscheidende Faktor nicht das Klima mit seinen Folgen ist, sondern die Fähigkeit oder Unfähigkeit der Gesellschaften, damit umzugehen. Japan, ein ab dieser Epoche vereinigter Staat mit einem Steuersystem und Verkehrswegen, die damals ihresgleichen suchten, der auf einem „Gesellschaftskompromiss“ zwischen dem Adel, der Handelsklasse und den bäuerlichen Eigentümern beruhte, wollte und konnte Lebensmittelvorräte anlegen und sie verteilen, den Reisanbau obligatorisch machen, die Mässigung erzwingen, den Aussenhandel reduzieren und von seiner geographischen Isolation profitieren, um Militärausgaben zu vermeiden. Somit konnte er die Auswirkungen der Krise und die dadurch ausgelösten Unruhen begrenzen.
Das 21. Jahrhundert unterscheidet sich vom 17.: Das kapitalistische System ist zu einer Kraft geworden, die fähig ist, die für die materiellen Bedingungen für dieses uns bekannte Leben auf der Erde notwendigen Gleichgewichte zu erschüttern und das nicht nur durch einen Atomkrieg, von dem es naiv wäre, zu glauben, dass er nie stattfinden werde. Unsere „globale Krise“ wird von einem anderen Ausmass sein als jene der „Kleinen Eiszeit“.
Dennoch ist der Klimawandel genauso wenig wie im 17. Jahrhundert ein neuer historischer Akteur, der das menschliche Handeln als entscheidenden Faktor ersetzen würde. Was wir „Natur“ nennen, spielt nur in Dynamiken eine Rolle, die aus gesellschaftlichen Situationen und Widersprüchen bestehen. Weder die Ursachen, noch die Lösungen sind zuerst physisch oder technisch.
2) Welche Grenze für die kapitalistische Produktionsweise?
Der Luftkrieg, ein 1907 veröffentlichter Roman von H. G. Wells, erzählt von einem Weltkrieg, geführt von den Luftflotten aller Länder, der die Welt verwüstet und die Menschheit in zwei Jahrzehnten in ein vorindustrielles Zeitalter zurückbringt.
Das ist das unwahrscheinlichste Szenario. Was auch immer geschehen mag, scheint es sicher, dass die Industriegesellschaft fortbestehen wird, auf andere Art und Weise. Zur Eisenbahn des 19. und der Autobahn des 20. Jahrhunderts werden der Riesendamm, die Bepflanzung zur Bindung von CO2 und Solarparks von 100 km² hinzukommen, darüber hinaus die Digitalisierung überall: Weder heute noch morgen wird die Ausbeutung der Kongolesen zur Extraktion von Coltan aufhören. Der Graben zwischen Reichen und Armen wird tiefer werden, die „Überentwicklung“ hier zur „Rückständigkeit“ dort führen (Anfang des 21. Jahrhunderts benutzt übrigens einer von drei Menschen fast keine fossile Energie und drei Viertel der Bauern benutzen nur Handwerkzeug). Das Afrika 2050 wird nicht dem aktuellen oder gar dem Europa von 1950 ähneln: Sowohl in Lagos als auch in Dakar werden die Privilegierten von der vierzigsten Etage ihres Hochhauses die ein paar Kilometer weiter entfernt aufgebauten Elendsviertel kaum sehen können.
Die Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise geht mit der Reproduktion des Menschengeschlechts und des Lebens auf der Erde einher und solange sie existiert, wird die kapitalistische Produktionsweise sie reproduzieren, zum Preis von Millionen von Toten heutzutage, vielleicht bald von Hunderten Millionen. Wenn es nur darum geht, die gesamte oder einen Teil der Natur zu zerstören, hat das System schon vieles gesehen, es zerstört die Lebensbedingungen, massakriert massenweise durch den Krieg, den Kolonialismus und den Völkermord. Die Verschmutzungen und ihre Verwüstungen wurden schon Anfang des 19. Jahrhunderts angeprangert und im Allgemeinen waren die Bourgeois nicht davon betroffen, sie wohnten weit vom giftigen Rauch entfernt. Die Existenz ist schon unerträglich für Hunderte Millionen, kaum erträglich für einige Milliarden: Die Tatsache, dass sich diese Situation auf Milliarden weitere ausweitet ist weder mit dem kapitalistischen System, noch mit dem Fortbestand seiner Führungsschicht inkompatibel: „Der Kapitalismus wird keines natürlichen Todes sterben.“ [25]
Die einzig nachhaltige kapitalistische Entwicklung ist jene seiner Führungsschicht, die, in ihren verschiedenen Formen, immer alles in ihren Möglichkeiten Stehende getan hat, um fortzubestehen, und bis zum heutigen Tage hat sie es geschafft, ohne kollektives Gehirn oder internationales Führungszentrum. In den 1920er und 1930er Jahren hat sich der aus dem Erdbeben des Krieges 1914-1918 (und gegen die revolutionäre Erschütterung) entstandene Völkerbund als unfähig erwiesen, eine internationale Ordnung aufrechtzuerhalten, für dessen Wiederaufbau es einen Zweiten Weltkrieg brauchte. Der Kapitalismus ist daran nicht gestorben – ganz im Gegenteil.
Die Bourgeoisie antwortet auf Krisen gemäss dem Kräfteverhältnis – d.h. ein Klassenverhältnis. Ende des 19. Jahrhunderts hat sie das Verhältnis Kapital/Arbeit umgebaut, indem sie damit begann, die Gewerkschaften zu integrieren und die sozialdemokratischen Parteien einzugewöhnen. Nach 1929 und 1939-1945 setzte die organisierte Arbeit einen weiteren Fuss in die Institutionen und die Bourgeoisie hat sich ein bisschen selbst diszipliniert. Gegenwärtig ist die Aufrechterhaltung der natürlichen Bedingungen für den Kapitalismus genauso notwendig wie jene der politischen Gleichgewichte im 20. Jahrhundert, aber die Führungsschichten können sowohl im Klimachaos als auch unter Kriegsbedingungen fortbestehen.
Und sogar mitten in der Katastrophe (über)leben. Wie wir vor etwa zwölf Jahren in Demain, orage bemerkten, werden vielleicht in hundert Jahren nur ein oder zwei Milliarden Menschen übrig bleiben, einige davon geflüchtet in den Untergrund, wie es THX 1138 zeigte (ein Film von George Lucas von 1971), die sich von synthetischer Nahrung ernähren, einige Überbleibsel der Menschheit bestehen an der Oberfläche fort, auf verschiedenen Niveaus der Barbarei oder des gemeinschaftlichen Überlebens. Schon heutzutage erleben wir die Produktion synthetischen Fleisches und die essbaren Insekten erscheinen in den Regalen der grossen Supermärkte. Die Erde wird schon bald unbewohnbar sein, wie es David Wallace-Wells im Buch mit ebendiesem Titel bekräftigt. Aber was heisst schon bewohnbar? „Man lehrt die Menschen alles“, schrieb Voltaire, „Tugend und Glaube“; wir würden die Not, die Enteignung, das Exil, den Verlust der Illusionen oder auch neue tödliche Ideologien hinzufügen...
Und vor der Erreichung der Grenzpunkte (die mehr oder weniger den bewusst alarmistischen Vorhersehungen von Wallace-Wells ähneln) wird sich der Prozess über Jahrzehnte erstrecken oder beschleunigen. Es bleiben Gas- und Ölreserven für einige Dutzend Jahre und Kohlereserven für mehr als ein Jahrhundert übrig: Ihre Gewinnung ist immer noch rentabel, sie liefern drei Viertel der konsumierten Energie und dieser Anteil wird umso langsamer schwinden, als dass die Multinationalen der „fossilen Energie“ immer noch zu den mächtigsten der Welt gehören. Wir laufen Gefahr, eine Mischung aus echten und falschen Reformen, eine zunehmende Verkünstlichung der Lebensweisen und parallel dazu die Entstehung alternativer Daseinsformen (zwangsläufige Notlösungen für die Verschlimmerung der sowohl klimatischen als auch gesellschaftlichen Verhältnisse) und die Selbstverwaltung des Elends unter der Regie einer Kombination von einem „überfürsorglichen Staat“ (nanny state), Sozialkrediten und omnipräsenter Überwachung wie in China und nationalen/ethnischen Rückschritten, zunehmender Identitätspolitik usw. zu erleben.
3) Auf der Coronaspur
Es gab „die Welt nach“ dem Mauerfall oder „die Welt nach“ dem 11. September 2001; heute sei es jene nach der Covid-19-Pandemie, die eine neue Ära ankündige, eine glückliche oder eine desaströse, oder die sogar – für die Radikalsten oder die Optimistischsten – endlich die tödliche Realität des Kapitalismus ans Licht bringe.
Aber was ändert sich wirklich, wenn der Tod in einem solch massiven Ausmass zuschlägt (am 15. Mai 2021 mehr als 3.3 Millionen Menschen gemäss Worldometers)? Und was zeigt die staatliche, politische, mediale usw. Behandlung davon?
In Wirklichkeit bringt diese Pandemie viel ans Licht, das wir schon wussten, und modifiziert wenig dessen, was die Bourgeois (durch ihre Funktion) und die Proletarier (durch ihre gegenwärtige Zerschlagung) unfähig sind, zu ändern.
Die Ungleichheiten werden in Anbetracht einer sie verschlimmernden Katastrophe noch deutlicher. Während dem „grossen Winter“ 1709 sterben Hunderttausende Arme den Kälte- und Hungertod, während in Versailles der Hof in seinen Spitzen überlebt. Drei Jahrhunderte und eine Industrielle Revolution später zeigt eine Welt, die sich für reich hält, ihre soziale und menschliche Armut und vor allem ihre tiefe Logik: Das Wesentliche der Wirtschaft und der Produktion, wenn auch verlangsamt, aufrechterhalten und dafür die Lohnarbeiter weiterhin zur Arbeit schicken, während elementare gesundheitliche Massnahmen ergriffen werden.
Einige haben die Verantwortung der kapitalistischen Produktionsweise in der Pandemie dargelegt: Wir werden nicht weiter darauf eingehen. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ereigneten sich von elf weltweiten Pandemien fünf im Verlauf der letzten 20 Jahre. Die Lohnarbeits- und Warenzivilisation hat Covid-19 nicht erschaffen, aber seine Ausbreitung durch die vermehrte Zirkulation der Menschen und Güter, eine ungesunde urbane Konzentration, die Verarmung der entwurzelten ruralen Massen, eine Agroindustrie, welche die Übertragung von Viren begünstigt, eine pathogene Lebensweise und Ernährung, welche die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck erhöhen (was in erster Linie die Ärmsten betrifft), und den Abbau der Systeme der sozialen Sicherung in den entwickelt genannten Ländern begünstigt.
Der Kapitalismus ist ebenfalls todkrank.
Die Antwort der führenden Eliten auf die Übel, zu deren Erschaffung er beiträgt, entspricht dem, was sie sind.
Foch verlangte 1916 100‘000 Handgranaten pro Tag für Verdun. Ein Jahrhundert später hat keine Regierung trotz der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einen grossen Plan zum Bau von Spitälern (ausser in China, sagt man) oder zur Ausbildung von medizinischem Personal aufgegleist. Gleichzeitig hat nichts den Abschuss in Richtung Mars des Roboters Perserverance gebremst, „konzipiert, um Biosignaturen von alten Mikroben zu entdecken, die sich womöglich vor drei Milliarden Jahren auf diesem Planeten tummelten“, und man eröffnete riesige Einkaufszentren. Der Unterschied zwischen 1916 und 2020-2021, zwischen einem europäischen Konflikt und einer allgemeinen Pseudomobilisierung für die Gesundheit ist, dass ein deutscher Sieg im Ersten Weltkrieg die Interessen der französischen Bourgeoisie und die Macht des französischen Staates getroffen hätte, während der Ausbruch einer weltweiten Pandemie seit Anfang 2020 keine Bedrohung für die Führungsschichten darstellt.
Es ist nie das Ziel einer Gesellschaft, ein Maximum an menschlichen Leben zu erhalten, sondern ihr Fortbestand. (Wenn übrigens die Rettung von Leben eine Priorität wäre, würde man gegebenenfalls entgegen der Wünsche der Bevölkerungen den Tabak, den Alkohol oder sogar den Zucker verbieten.) Die erste Sorge der Bourgeois ist, dass die Wirtschaft weiterhin läuft. Jene der Staaten ist, dass die Spitäler nicht allzu offensichtlich überfordert sind: „[D]ie Überzeugung, dass das Niveau des Drucks auf die Gesundheitssysteme – eher als die absolute Zahl der Todesfälle oder Ansteckungen – der entscheidende Faktor für die Ergreifung der auf eine Begrenzung der Mobilität der Individuen und, mit ihnen, der Ausbreitung des Virus abzielenden Massnahmen durch die Nationalstaaten sein würde […]“ [26]
Obwohl die Verwaltung des Virus tatsächlich einer „Biopolitik“ auf weltweiter Ebene gleichkommt, ist sie untrennbar mit einer sehr kapitalistischen „Gesundheitswirtschaft“ verbunden, sie vermischt Buchhaltung und Medizin und in ihr folgt die Verwaltung der Flüsse den Logiken von Angebot und Nachfrage im Pflegebereich. Was die Unternehmen der Big Pharma betrifft, befürchten sie nicht im Geringsten, dass sie verstaatlicht oder dass ihre Impfstoffe zu „Gemeingütern“ werden.
Was ist das Leben wert? Unsere Episode 3 erinnerte daran, dass der World Wild Fund die „ozeanische Schatzkammer“ auf 24‘000 Milliarden Dollar schätzt, während die gelehrten Berechnungen die menschlichen Kosten der durch die Klimaerwärmung verschlimmerten Naturkatastrophen zwischen 1980 und 2012 auf 2.5 Millionen Menschen schätzen, was, gemäss den Statistikern, 3‘800 Milliarden Dollar entspricht.
„Das Leben hat keinen Preis“, sagt man. Im Gegenteil: In einer von Geld beherrschten Gesellschaft ist das Leben ein in Geld messbares Gut und in einer von einer systematischen Verringerung der Produktionskosten bestimmten kapitalistischen Gesellschaft wird das Leben gemäss einem Kosten-Nutzen-Verhältnis beurteilt.
Ein Jahr in guter Gesundheit sei scheinbar in den Niederlanden 80‘000 Euro wert. Um den finanziellen Wert einer Intervention oder einer Behandlung zu bestimmen, denken Spitalmanager und Versicherer in QALYs (quality-adjusted life year), d.h. in gemäss ihrer Qualität beurteilten Lebensjahren: Ein Jahr in „perfekter Gesundheit“ ist 1 QALY wert, Sterben 0 QALY, und die anderen Gesundheitszustände befinden sich dazwischen. In Kanada hat zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Analyse von Natalizumab das dank dieses Medikaments gegen die Multiple Sklerose erhaltene QALY auf 68‘600 Dollar geschätzt, verglichen mit „dem Verzicht auf Behandlung“.
Wieso sollte sich die Medizin mehr als die Schule oder die Autoindustrie der Kommodifizierung und den Geboten der Rentabilität entziehen?
Die Pandemie zeigt die Zerbrechlichkeit eines Systems auf, das fähig ist, sich zu vertiefen und auszuweiten, aber auch seine Fähigkeit, anzudauern. Für die Bourgeois ist die Gesundheitskrise nicht minder ein Problem als eine Lösung: Sie beschleunigt schon bestehende Tendenzen, obwohl sie zu gewissen bescheidenen Konzessionen verpflichtet. So verteilt man also ein bisschen Einkommen: Das Geld, von dem man uns 2019 wiederholte, dass es nicht vom Himmel falle, tut das plötzlich in Form von Krediten. Aber es wird genauso wenig einen neuen Keynesianismus geben, wie die Wahl des 46. Präsidenten der USA eine Kurskorrektur ankündigt. Die herrschenden bürgerlichen Schichten – die Banken, die Finanz, die Multinationalen – behalten die Macht und „der freie und unverfälschte Wettbewerb“ bleibt die Regel.
Ökologisch wird der Planet 2020 allerhöchstens drei Wochen gewonnen haben: Die provisorische Verlangsamung der Produktion hat den „Tag der Überschreitung“ um etwas weniger als einen Monat verzögert, das Datum, an welchem die Menschheit alle Ressourcen konsumiert, welche die Ökosysteme in einem Jahr produzieren können.
Eine „aussergewöhnliche Verzögerung“, betonen die Scharfsinnigsten. Keine der Ursachen der Klimaerwärmung wird durch die Behandlung einer Gesundheitskrise, die selbst Teil der Umweltkrise ist, verringert werden. Der Widerspruch zwischen der kapitalistischen Produktionsweise und ihren natürlichen Grundlagen verschlimmert sich. Verschmutzung, Verschlechterung der Biodiversität, Entwaldung und Monokultur werden weitergehen und die Entstehung neuer Pathologien begünstigen.
Es wird weder zu einer Wende noch zu einem ökologischen „Aufschwung“ kommen. Betrübte Geister bereuen die verpasste Gelegenheit. Aber warum und wie hätten wir sie ergreifen können? Und wer ist dieses „wir“?
Was hat Fukushima in zehn Jahren verändert? Die Atomenergie existiert weiterhin und macht sogar Fortschritte in gewissen Ländern, sie ist faktisch von den Grünen anerkannt, ihre prinzipielle Verweigerung hat sich in eine einfache Forderung nach strengeren Normen verwandelt. Zunehmend ist man gar der Meinung, die Atomenergie habe den Verdienst, „emissionsfrei“ zu sein und zur Senkung des CO2-Ausstosses beizutragen. Parallel dazu verstärken sich das Wachstum einer energieintensiven Digitalisierung und die Entwicklung hin zu einem reinen Elektrobetrieb. Der Ökozid ist noch lange nicht vorbei.
Der soziale oder politische Protest geht kaum gestärkt daraus hervor.
An der Spitze behaupten die reformistischen Parteien, ihre künftige „ökologische Planung“ führe zu 100% erneuerbaren Energien 2050 – aber sie ziehen keine wirkliche Reduzierung der industriellen Produktion oder des Energiekonsums in Betracht. Es geht immer weniger darum, bezüglich der Ursachen des Klimawandels zu handeln, nur darum, seine Auswirkungen zu dämpfen. Man versucht nicht, Energie zu sparen, nur gleich viel (oder gar mehr), aber anders zu produzieren. Was die vorhersehbaren Umwelt- und Gesundheitskatastrophen betrifft, ist die vorherrschende Forderung jene nach einer Erhöhung der Gesundheitsbudgets. Das ist gleichbedeutend mit der Reduzierung des Problems auf einen Mangel an – materiellen und menschlichen – Mitteln, als ob unsere gesundheitliche Bedingung von wiederherstellenden Strukturen abhinge: Die Gesellschaft begnügt sich damit, das zu heilen, was sie nicht verhindern kann.
Grundsätzlich machen die Kritischsten sehr wohl grossmehrheitlich den Kapitalismus für die Pandemie verantwortlich, aber für sie wäre die Emanzipation davon gleichbedeutend mit einer Vervielfachung gesellschaftlicher Experimente und lokaler Praktiken der Selbst-Selbstregierung, deren Ausweitung die Logik des Kapitals und die Macht des Staates zunehmend unwirksam machen würden. Eine Veränderung revolutionären Ausmasses also – ohne diesen „alten Zopf“ namens Revolution.
Man hat jenen Strassenausbau für die Fahrräder 2020 zur Entlastung der öffentlichen Transporte und der Begünstigung von Sicherheitsabständen und gleichzeitig der Förderung einer nicht verschmutzenden „Mobilität“ „Coronaspuren“ genannt. Die Umweltschützer kämpfen nun dafür, dass die Coronaspuren, die als provisorisch konzipiert waren, aufrechterhalten und ausgeweitet werden.
4) Was von uns abhängt
Das Schlimmste ist nur für die Prediger der Resignation gewiss. Yves Cochet (früherer Umweltminister, heute prominenter Zusammenbruchstheoretiker) kündigt uns „einen unumkehrbaren Prozess“ an, „an dessen Ende die Grundbedürfnisse (Wasser, Ernährung, Wohnen, Kleidung, Energie usw.) der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr durch gesetzlich garantierte Dienstleistungen befriedigt werden“.
Seit jeher wiederholten die Verteidiger der herrschenden Ordnung, dass die Ausbeutung, die Unterdrückung, die Ungleichheit und der Krieg unausweichlich seien und nur abgemildert werden können. Sie wenden diesen Diskurs heute auf das Klima an. Entweder bestreiten sie die ökologische Katastrophe oder sie erklären unsere Lage für ausweglos. Die Idee eines Fortschrittes, einer verbesserungsfähigen Menschheit wird umgekehrt: Die Geschichte hätte sich in Richtung des bestmöglichen Ausgangs entwickeln sollen, sie entwickle sich nun in Richtung des schlimmstmöglichen. Der bürgerliche – und sozialistische – Messianismus erliegt den Prophezeiungen des Unglücks. Die materielle (und somit intellektuelle, affektive, spirituelle…) Verbesserung war durch die Gesetze der Geschichte garantiert, nunmehr wird einzig die Katastrophe versprochen.
Die politische Moral bleibt ihrerseits unverändert. Im 19. und dann im 20. Jahrhundert musste man die bürgerliche Herrschaft im Namen des Optimismus bezüglich Wachstum akzeptieren, denn was auch immer die Probleme sein mögen, für den Kapitalismus ist nichts unmöglich. Im 21. Jahrhundert müsste man ihn im Namen des Pessimismus hinsichtlich eines möglichen Zusammenbruches akzeptieren, denn was auch immer die Übel sind, die uns erwarten mögen, nur der Kapitalismus und seine Führer werden sie beseitigen können, mehr oder weniger gut oder schlecht, aber alles ist besser als Chaos.
Für fast die gesamte (bürgerliche oder proletarische) Bevölkerung ist heute eine tiefe Zerstörung der Erde einfacher vorstellbar als ein Bruch mit dem Kapitalismus.
Obwohl das menschliche Handeln wahrscheinlich einer der Hauptfaktoren für die klimatische, geologische usw. Entwicklung geworden ist, bedeutet das nicht, dass seine Folgen nunmehr unumkehrbar wären. Alles wird von der Fähigkeit der Proletarier abhängen, zu unterscheiden zwischen dem, was nicht von ihnen, da Produkte vergangener und gegenwärtiger Niederlagen, und dem, was von ihnen abhängt, da es durch ihre Reaktion veränderbar ist.
5) Revolution
In Tarente in Apulien lief das grösste Stahlwerk Europas (der Ilva-Gruppe), es war der erste Arbeitgeber der Stadt und verantwortlich für eine aussergewöhnliche Todesrate aufgrund der durch die Hochöfen verursachte Verschmutzung.
Vor etwa zehn Jahren führt die weltweite Krise der Stahlindustrie dazu, dass Ilva das immer weniger rentable Werk progressiv schliesst und die Proletarier stehen vor der Alternative, „an Hunger“ da arbeitslos oder „an Krebs“ bei der Arbeit „zu krepieren“. Am 2. August 2010 wird ein von den Gewerkschaften und den lokalen Behörden organisiertes Treffen mit dem Motto „Retten wir unsere Arbeitsplätze“ (angeblich die Politik des geringeren Übels) von mehreren Hundert Personen gestört, die ein „Freies und bewusstes Bürger- und Arbeiterkomitee“ ins Leben rufen und zugleich die Schliessung des Stahlwerks und die Kostenübernahme durch die Ilva für die Behebung der durch sie verursachten menschlichen und Umweltschäden fordern. Das Komitee organisiert sich autonom gegenüber den gewerkschaftlichen und politischen Apparaten. Gemäss den Worten einer Einwohnerin von Tarente: „Es ist, als ob wir unser Schicksal wieder in die eigenen Hände genommen hätten.“ Einige Jahre später spielt Arcelor-Mittal mit dem Gedanken, die Fabrik aufzukaufen (unter der Bedingung, dass der italienische Staat für die Sanierung aufkommt), sieht davon ab und das Personal wird nach und nach entlassen. Das Komitee überlebt und denkt über Aktivitäten nach, die jene der Fabrik ersetzen könnten (die Renovation der Altstadt, die Restaurierung der antiken griechischen Ruinen, die Wiederbelebung der Fischerei), Projekte, deren Verwirklichung voraussetzen würde, dass anderswo Mobilisierungen einer anderen Art entstünden, welche die gemeinsame Wurzel der verschiedenen Situationen angehen.
In vielen Fällen hat die Desertion von abstumpfenden Arbeitsplätzen die Unterbrechung der sowohl für die Ausgebeuteten als auch für die Umwelt schädlichen Produktionen zur Folge. Im Iran von 1979 hatten die Proletarier selbst, indem sie massiv die menschlich nutzlosen Industrien verliessen, ein so sehr von den radikalen Umweltschützern herbeigewünschtes Postwachstum begonnen. Die Streikwelle hatte sogar „dem Himmel wieder seine Farbe zurückgegeben“, berichtete ein Zeuge, „durch den Unterbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Die Revolution war vorübergehend stärker als die Verschmutzung.“
Es gibt und wird immer mehr als „ökologische“ bezeichnete Kämpfe geben, sie verlieren häufig und gewinnen manchmal – es sind auch soziale Kämpfe gegen die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen: Widerstand eines „Waldvolkes“ in Brasilien gegen die Entwaldung des Amazonas, Ecuadorianer, welche die bergbauliche Ausbeutung ihres Territoriums ablehnen, Revolte der birmanischen Landwirte, die wegen des Baus einer Pipeline enteignet worden sind, Mobilisierung eines Dorfes in China gegen eine Fabrik, die ihre Abfälle ins Meer leitet, Aufstand enteigneter Bauern, „Durst-Proteste“ in Marokko, Blockierung des Transports nuklearer Abfälle, Krawalle im Irak für den Zugang zu Trinkwasser… Alles Kämpfe, die dazu tendieren, die Unterscheidung zwischen „ökologisch“ und „sozial“ zu überwinden.
Diese Akte des Widerstands sind defensiv und versuchen häufig, eine Gemeinschaft kleiner Produzenten wiederherzustellen, die durch die neuen zeitgenössischen „enclosures“ enteignet worden sind. Wenn sie mit einer gesellschaftlichen Umstrukturierung begannen, bemächtigten sich die vergangenen Erfahrungen (die Pariser Kommune und die russische und spanische Revolution sind die bekanntesten davon) der Werkstätten, Fabriken, Züge und des Landes – um sie in mehr oder weniger kollektiver Verwaltung zu reaktivieren. Aber man zahlte weiterhin (manchmal gleiche) Löhne aus und mass weiterhin den produktiven Beitrag – die Produktivität also – von jedem, indem seine Arbeitszeit gezählt wurde, um die Produktion zu steigern. Das ging einher mit dem Fortbestand der Trennung in Unternehmen, jedes davon wurde aufgrund seiner buchhalterischen Bilanz evaluiert. Die Aufrechterhaltung der Lohnarbeit und des Unternehmens – zwei charakteristische kapitalistische Züge – wurde mit der Notwendigkeit einer gegenüber einer zu allem bereiten Konterrevolution unentbehrlichen produktiven Effizienz gerechtfertigt. Genau das war hingegen die Ursache des Scheiterns: Eine Revolution, die dem Proletarier allen voran eine Rolle als Arbeiter, wenn auch „assoziiert“, anbietet, definiert durch seinen Auftrag für die Produktion und seinen Beitrag dazu, ist unfähig, jene breiten Massen anzuziehen, welche für ihre Ausweitung und dann ihren Erfolg notwendig (aber nicht hinreichend) sind.
Heute sind es weder eine autonom gewordene Megamaschine noch eine den Menschen inhärente Masslosigkeit, die zur „(maximalen) Entwicklung der Produktivkräfte“ drängen, es ist die Konkurrenz zwischen Unternehmen. Indem er mit der Messung des individuellen Beitrages und der Existenz rivalisierender Wertpole brechen würde, würde ein kommunistischer Aufstand faktisch mit einem „ökologischen Übergang“ beginnen, besonders durch die Einführung neuer Arten der Produktion und der Nutzung der Energie. Der Gedanke, dass, wenn die Männer und Frauen sich mehr oder weniger überall ihrer Existenzmittel bemächtigt haben werden, sie naheliegende Energiequellen und -formen priorisieren würden, und nicht weit weg von ihnen produzierte Infrastrukturen, die sie nicht kontrollieren können, ist alles andere als utopisch.
Soweit sind wir noch nicht, doch wir kennen Versuche, nicht nur um ohne Geld zu produzieren und zu leben, sondern für eine produktive Aktivität, die nicht nur produktiv ist (das sie in Form von Arbeit ist und sie definiert). Nach der argentinischen Krise 2001 haben gewisse Piqueteros Produktionen aufgebaut, deren einziges Ziel nicht das Produkt war. In einer Bäckerei waren die Brote, die aus dem Ofen kamen, das Resultat neuer zwischenmenschlicher Beziehungen, deren Aktivität, unter anderen, jene einer Bäckerei waren, doch die Produktionsstätte war gleichzeitig eine Lebenswelt.
Wie jener des vorhergehenden Kapitels war dieser theoretische Umweg notwendig. Das Ende des Produktivismus und des Hyperkonsums (von „Waren, die nur Sklaven brauchen“, sagte William Morris) ist inkompatibel mit der Existenz einer Welt, in welcher das Unternehmen, die Lohnarbeit, die Ware und die Produktivität (auch abgemildert und demokratisiert) fortbestehen würden. Die (politische) „Konvergenz“ der „Kämpfe“ ihrerseits, die nur eine Gegenüberstellung von Rot und Grün während einer Demo oder eines Wahlprogramms ist, hat nichts mit der die kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse beseitigenden Revolution zu tun.
6) ...kein Motiv für Hoffnungslosigkeit
Niemand weiss, ob vor dem Ende des Jahrhunderts die Durchschnittstemperatur um 2, 3 oder 5 Grad gestiegen oder wie weit der Meeresspiegel 2049 angestiegen sein wird.
Die Verantwortung eines Menschengeschlechts, das seit zwei Jahrhunderten unter dem industriellen Kapitalismus lebt, ist hingegen gewiss.
Genau wie es gewiss ist, dass die Kapitale weiterhin Kohle-, Öl- und Gasreserven ausbeuten werden, solange sie wirtschaftlich rentabel bleiben.
Wir wissen vor allem, dass kein grüner Kapitalismus, kein heute konzipierbarer Ökokapitalismus die Hyperproduktion und somit den Hyperkonsum beenden wird, die für dieses Produktionssystem notwendig sind. Was sich abzeichnet – unter anderem die Tendenz hin zu einem komplett digital verwalteten, reinen Elektrobetrieb – wird die ökologischen Zerstörungen etwas abmildern, ohne ihre Ursachen zu beseitigen. Die Frage ist nicht das Mass an Präzision der Vorhersagen, sondern die Kämpfe und Praktiken, welche die Proletarier gegenüber dieser Welt ins Feld führen und führen werden.
Heute scheinen die Widerstände, die Konfrontationen, die Klassenantagonismen weit davon entfernt, eine günstige Situation für die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus zu erschaffen.
Heute gewiss. Doch es geht uns nicht darum, zu erraten, ob die Chancen auf eine siegreiche Revolution bei 10% oder 1% stehen. Denn es ist wahr, dass „es etwas Lächerliches dabei gibt, von der Revolution zu sprechen […] Noch viel lächerlicher aber ist ALLES ANDERE, da es sich um das Bestehende handelt und um die verschiedenen Formen seiner Duldung“, sagten die Situationisten. Die moderne kommunistische Theorie begann in den 1840er Jahren, sich auszudrücken, das ist schon bald zwei Jahrhunderte her, aber, bekräftigte Fourier 1816, „Verspätungen sind kein Motiv für Hoffnungslosigkeit“.
G. D., Mai 2021
Dieser Artikel ist die letzte Episode in der Reihe „Kartoffeln gegen Wolkenkratzer. Zur Ökologie“.
Literaturverzeichnis
Zitat des spanischen Gewerkschafters: Dos Passos, Rosinante to the Road again (1922), Skomlin, 2011.
Zur „Kleinen Eiszeit“: Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the 17th Century, Yale University Press, 2013. Eine detaillierte Vergleichsstudie aller betroffenen Regionen auf dem ganzen Planeten. Eine kurze Rezension gibt es hier.
H. G. Wells, Der Luftkrieg (1907), Henricus, 2022.
Troploin, Demain, orage. Essai sur une crise qui vient, 2007.
David Wallace-Wells, Die unbewohnbare Erde: Leben nach der Erderwärmung, Ludwig, 2019.
Tristan Leoni und Céline Alkamar, „Quoi qu’il en coûte. Le virus, l’État et nous“, April 2020.
G. D., „Virus, le monde aujourd’hui“, September 2020.
Il lato cattivo, „Noch mal zu Covid-19 und darüber hinaus“, Februar 2021. Situation und Entwicklung des Kapitalismus in Anbetracht der Pandemie, geopolitische Faktoren – eine sehr gute Erörterung. „Entgegen weit von jeglichem Realitätsprinzip entfernten hypersubjektivistischen Sichtweisen ist keine Konkretisierung der kommunistischen Perspektive in Europa ohne Bruch der gesellschaftlichen Gleichgewichte in seinem produktiven Kern möglich.“ Im Zentrum dieses produktiven Kerns, so zeigt es der Text auf, ist Deutschland.
Ernest Silva, „Quelques réflexions sur la catastrophe en cours“, April 2021.
Für eine Zusammenfassung der verschiedenen zeitgenössischen Illusionen, die eine nicht minder totale als friedliche Umwälzung versprechen: „2025. Après la révolution“.
Riesendemos, Hungeraufstände, Ausweitung autonomer Zonen, Börsencrash, Zusammenbruch der Banken, Machtlosigkeit der Regierungen in Anbetracht des gesellschaftlichen Drucks – all das führe ohne exzessive Gewalt zu einer direkten Demokratie, einer verallgemeinerten Selbstverwaltung, einem libertären Munizipalismus und einem auf den gesamten Mittleren Osten ausgeweiteten Rojava. Die Krise 1929 hatte nicht zum Zusammenbruch des weltweiten Systems geführt: Eine Pandemie wird dafür ausreichen. Den Autoren fehlt es nicht an Humor, in der Regel unfreiwillig.
Zum Stahlwerk von Tarente: An A to Z of Communisation, § „Ecology“, 2015.
Zum Iran 1979: Tristan Leoni, La Révolution iranienne. Notes sur l’islam, les femmes et le prolétariat, Entremonde, 2019.
William Morris, „Die Gesellschaft der Zukunft“, 1887.
Zu dem, was eine kommunistische Revolution tun würde, verweisen wir einmal mehr auf Bruno Astarian, Activité de crise et communisation, 2010.
Und auf unser De la crise à la communisation, Entremonde, 2017, Kapitel „L’insurrection créatrice“
Zitat der Situationistischen Internationale aus dem Artikel „Instruktionen für eine Parade“, Nr. 6, 1961.
Fourier, Aus der neuen Liebeswelt (1816), Wagenbach, 1967.
Übersetzung von London Calling:
„Die Eiszeit bricht herein, die Sonne kommt näher,
Die Maschinen kommen zum Stillstand und die Getreideernte wird schlecht,
Ein Nuklearunfall, aber ich habe keine Angst.“
Und falls das schöne Venedig unter den Wassern verschwinden würde? Vor den Ruinen der bombardierten Kathedrale von Reims sagte Felix Vallotton: „Wir werden etwas anderes tun, das ist alles, und es wird es wert sein.“ Tagebuch, 10. März 1915.
Übersetzt aus dem Französischen von Kommunisierung.net
[1] Il programma comunista, Nr. 5, 5.-19. März 1954.
[2] Jérémie Cravatte, L’effondrement, parlons-en... - Les limites de la „collapsologie“, 2019.
[3] Marx, Das Kapital, Bd. 1, 1867 in MEW, Bd. 23, S. 529-530.
[4] Engels, Dialektik der Natur, 1883 in MEW, Bd. 20, S. 452-453.
[5] Ebd., S. 453-455.
[6] Marx, Das Kapital, Bd. 3 in MEW, Bd. 25, S. 821.
[7] Amadeo Bordiga, „Piena e rotta della civiltà borghese“, 1952.
[8] Amadeo Bordiga, „Specie umana e crosta terrestre“, 1952.
[9] Amadeo Bordiga, „Politica e ‚costruzione‘“, 1952.
[10] Il Programma comunista, Nr. 6, 19. März – 2. April 1954.
[11] Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1 in MEW, Bd. 23, S. 618-621.
[12] Philippe Bihouix.
[14] Pour éviter le chaos climatique et financier, Seuil, 2017.
[15] Andreas Malm.
[16] SI, Nr. 7, 1962.
[17] Andreas Malm, „The Anthropocene Myth“.
[18] Jérémie Cravatte.
[19] Opuscules de philosophie sociale, 1819-1826.
[20] Pourquoi tout va s‘effondrer, Les Liens qui libèrent, 2018.
[21] Kapitel 8, § 7.
[22] Kapitel 21, § 1 und 2.
[23] Anti-Dühring, 1878.
[24] Das Elend der Philosophie.
[25] Walter Benjamin, Das Passagen-Werk.
[26] Il lato cattivo.




